Herr Tochtermann, es mag zynisch klingen, aber bringt Covid-19 den Durchbruch für Open Science?
Fest steht, dass durch Covid-19 in jedem Fall viel mehr Studien im Sinne von Open Science veröffentlicht werden als zuvor. Wir haben sowohl mehr Open-Access-Publikationen als auch frei verfügbare Forschungsdatensätze, die unter anderen Rahmenbedingungen nicht zugänglich gewesen wären.
Impact of Science
Offen durch die Krise
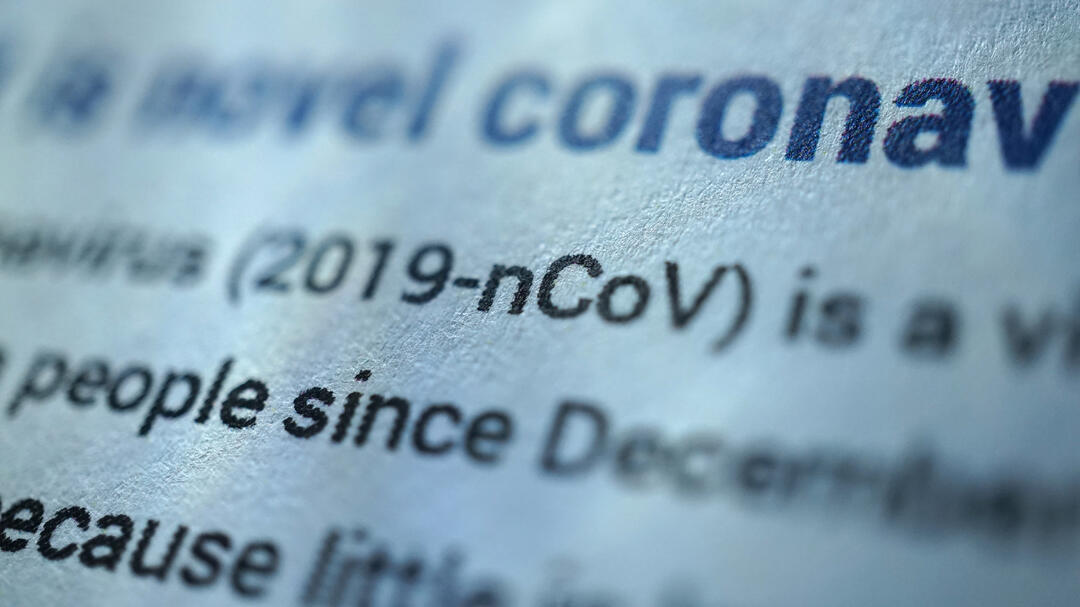
„Die Verlage können es sich heutzutage nicht mehr leisten, relevante Informationen hinter der Bezahlschranke zu halten.“
Was macht Sie sicher, dass gerade Maßnahmen wie die Preprint-Veröffentlichungen keine Schnellschüsse sind, sondern wirklich nachhaltig Open Science fördern?
Ich bin überzeugt davon, dass für die Verlage mit den Preprint-Publikationen ein Mehrwert entsteht. Dieser mag sich vielleicht nicht direkt monetär abbilden, aber indirekt schon, etwa durch einen Imagegewinn oder durch höhere Sichtbarkeit. Die Verlage können es sich heutzutage nicht mehr leisten, relevante Informationen hinter der Bezahlschranke zu halten. Open Science ist keine neue Bewegung, sondern schon sehr lange aktiv. Bedauerlicherweise hat man erst jetzt ein Beispiel, bei dem die Vorteile offenkundig werden.
Erstaunlich ist, dass jetzt auf einmal auch Prozesse umgesetzt werden, über die zuvor jahrelang gestritten wurde. Die Hochschulen beispielsweise führen die Lehre im laufenden Sommersemester fast durchgängig digital durch.
Auf einmal müssen Dinge funktionieren, über die man vorher sehr lange diskutierte, zum Beispiel in welchem Umfang digitale Lehre angeboten werden kann oder was bei Vorlesungen oder Seminaren alles datenschutzrechtlich zu beachten ist. Die Hochschulen mussten reagieren, sonst hätten sie Studierende verloren. Letztlich ist es für sie ein großer Schritt nach vorne.

Aber manche Probleme wie etwa der Datenschutz sind immer noch nicht gelöst.
In der Tat, darüber wird weiter diskutiert. Wenn bei Onlinevorlesungen die Klarnamen der Studierenden aufgezeichnet werden, sind das personenbezogene Daten. In diesen Fällen müssten die Lehrenden angeben, wo die Vorlesung wie lange gespeichert wird und was weiter mit dem Mitschnitt passiert. Auch wenn Dozenten aus ihren Privaträumen lehren, entstehen personenbezogene Daten. Derzeit herrscht da eine gewisse Toleranz. Interessant ist auch, dass Anbieter von Konferenztechnologien wie etwa Zoom, WebEx oder DFNconf, die gerade einen Ansturm erleben, nun sehr genau darauf achten müssen, wo die Daten abgelegt werden und dass diese nicht geleakt werden. Das hat für Anwender den Vorteil, dass diese Systeme dadurch sehr viel sicherer und datenschutzkonformer werden. Dieser Innovationsschub hätte ohne die Coronakrise länger gedauert.
Das klingt alles positiv für Open Science. Woran hapert es denn noch?
Was sich noch nicht geändert hat, ist das Creditsystem der Wissenschaft, also die Frage, wie wissenschaftliche Leistungen bewertet werden. Eine Preprint-Publikation oder eine Veröffentlichung von Daten auf dem EMBL-Webportal bedeuten nicht, dass Wissenschaftler auf eine Zeitschriftenveröffentlichung mit hohem Zitationsfaktor verzichten wollen. Dieser Wandel ist noch nicht erreicht. Da braucht es noch eine Generation von Wissenschaftlern, bis sich das ändert. Und auch die Fördermechanismen in der Wissenschaft sind nicht flexibel genug und zu langsam. Die EU-Kommission hat derzeit eine Ausschreibung bis Juni geöffnet, mit der sie Maßnahmen zur Weiterentwicklung für die European Open Science Cloud, kurz EOSC fördern will. Aus Reihen der Wissenschaft wie etwa der GO-FAIR-Initiative wurde angeregt, dass damit auch Covid-19-Konsortien gefördert werden sollten, weil das jetzt relevant ist. Das ging aber aus juristischen Gründen nicht, die Ausschreibung ließ sich nicht mehr ändern.
„Wir brauchen mehr Transdisziplinarität, ein ureigenes Merkmal von Open Science.“
Wenn die aktuelle Viruswelle vorbei ist, welche Lehren wären daraus zu ziehen, um Open Science und Open Innovation in Science weiter zu stärken?
Ich würde mir dann wünschen, dass die Wissenschaft in Ruhe analysiert, welche Rolle sie in der Pandemie gespielt hat. Wir hatten im Jahr 2011 mit dem Auftreten von EHEC-Erregern eine ähnliche, wenngleich nicht ganz so gefährliche Situation. Der Ausbruch der Epidemie wurde mit den Prinzipien von Open Science bekämpft: In der British Library wurde die Genomsequenz des Bakteriums veröffentlicht. Zudem wurde eine Plattform eingerichtet, auf der sich Bakteriologen austauschen konnten. Viele von ihnen schrieben an einer gemeinsamen Open-Access-Publikation mit. Das alles half mit, sehr schnell Gegenmittel gegen den Erreger zu entwickeln. Dies war ein gelungenes Beispiel, wie Open Science funktionieren kann. Doch leider war es offensichtlich nicht nachhaltig.
Warum nicht?
Man hätte damals EHEC nicht so schnell bekämpfen können, wenn es nicht diese Transparenz im Wissenschaftssystem gegeben hätte. Ich hoffe, dass wir künftig bei weiteren Ausbruchsgeschehen analytischer vorgehen. Epidemien und Pandemien werden immer wieder kommen. Die Wissenschaft muss nicht immer aufs Neue überlegen, was sie tun sollte. Jetzt funktioniert es gerade noch so, aber nur weil die IT-Technologien und -Infrastrukturen ausgereifter sind – und nicht, weil unsere Konzepte besser sind. Was immer noch fehlt, ist eine Art Handbuch, wie Wissenschaft derartigen Seuchen generell besser entgegentreten kann. Mediziner, Virologen, Lebenswissenschaftler, Forschungsdatenmanager und Betreiber von IT-Forschungsinfrastrukturen sollten zusammenkommen und sich Lösungen überlegen. Notwendig ist mehr Transdisziplinarität, ein ureigenes Merkmal von Open Science.
Mit innOsci hat der Stifterverband im Herbst 2019 ein Forum für offene Innovationskultur ins Leben gerufen. Das Forum versteht sich als Plattform, Think Tank und Experimentierraum für eine neue, offene Innovationskultur und will die Diskurse dazu bündeln. Das Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die Initiative.





