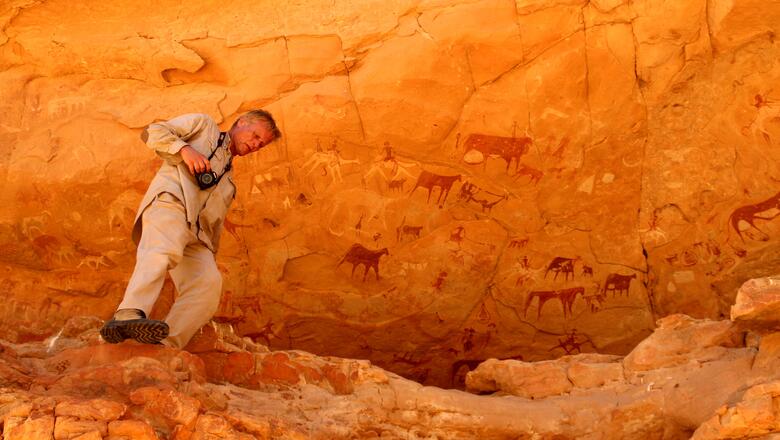Ohne ResearchGate hätten sich Rafael Luque und Rick Arneil Arancon wohl nie kennengelernt. Der Student Arancon zerbrach sich auf den Philippinen den Kopf darüber, wie und ob sich Altöle in Biokraftstoff umwandeln lassen würden. Könnten Maiskolben dafür als eine Art Katalysator dienen? Der Nachwuchsforscher durchforstete zu dieser Frage die Fachliteratur, suchte Experten – ohne Erfolg. Bis er eine Anfrage zu seinem Problem im neuen Wissenschaftsnetzwerk ResearchGate veröffentlichte. Rafael Luque, Professor im fernen Spanien, sah den Post und half dem philippinischen Studenten zunächst mit Tipps, später mit Tests in seinem Labor. Die Onlinediskussionen des ungleichen Wissenschaftler-Tandems wurden enger, mündeten gar in eine gemeinsame Publikation. Schließlich holte der Professor den jungen Philippinen gar als Assistenten zu sich nach Spanien.
Impact of Science
„Offene Forscher sind erfolgreicher“
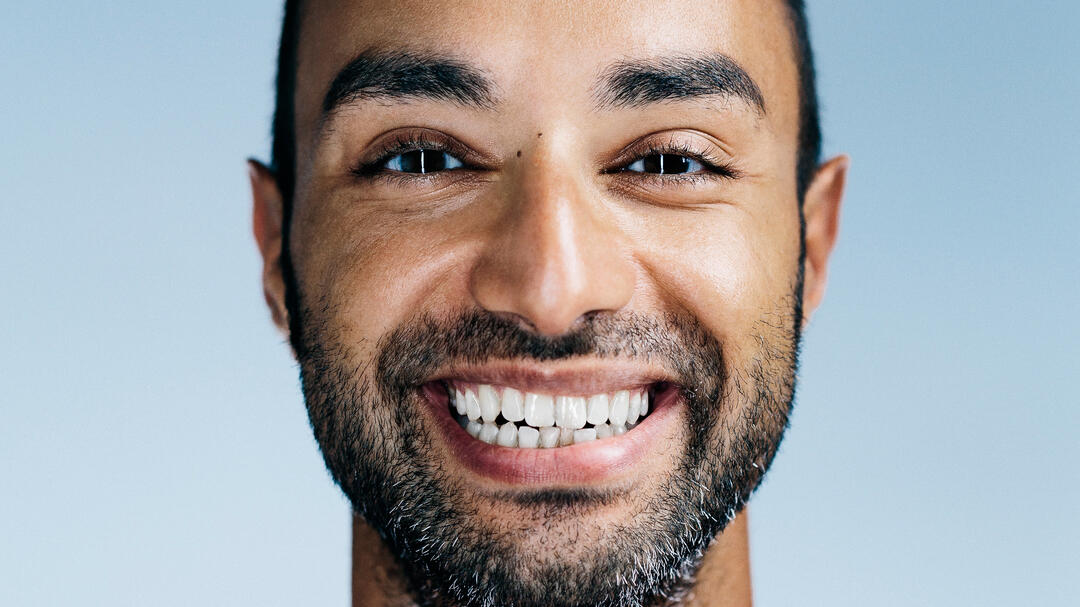
Nicht nur Wissenschaftler, auch prominente Investoren wie Microsoft-Gründer Bill Gates glauben an das Science-Start-up aus Berlin. Obwohl – oder vielleicht weil – der Gründer nach eigenen Angaben vor allem seiner Idee und weniger dem Geld folgte. „Ich habe mich von Anfang an von ResearchGate nicht als Unternehmer gesehen, sondern als Forscher, der ein Problem zu lösen hat“, versichert Ijad Madisch. ResearchGate sei am Puls der Scientific Community, weil er von seinen eigenen Bedürfnissen als Forscher ausgegangen sei.
2007 kam der studierte Arzt und Informatiker Madisch, der damals gerade an der Harvard Medical School forschte, bei einem Experiment nicht weiter. Er durchsuchte Google, stöberte in Datenbanken – ohne Erfolg. Am meisten, sagt der promovierte Virologe, habe ihn dabei die Ineffizienz der Suche frustriert. Madisch fand relevante Informationen entweder weit verstreut oder hinter hohen Bezahlschranken verborgen. „Forscher hatten keinen Ort, an dem sie all ihre Informationen zusammenfassen, zugänglich und durchsuchbar machen konnten für ihre Kollegen in aller Welt. Genau das haben wir geschaffen.“ Das Profil von ResearchGate führt nun den Lebenslauf und die Publikationen von Wissenschaftlern im Open-Access-Format zusammen. Dort können sie Forschungsvorhaben vorstellen und sich mit Gleichgesinnten zur Diskussion und Lösung von Problemen vernetzen.

Wissenschaftliche Qualitätskontrolle im Netz
Mit der Fokussierung auf digital getriebene Offenheit und Zugänglichkeit traf ResearchGate den Nerv der Zeit. Forscher, die über Facebook und WhatsApp Erfahrungen von niedrigschwelliger Vernetzung und unkompliziertem Austausch gemacht hatten, fragten sich: Warum soll dies nicht auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft funktionieren? Mit ihrer zunehmenden digitalen Vernetzung stellten sie die herkömmlichen wissenschaftlichen Prozesse infrage. Die Peer-Review-Begutachtungsverfahren sahen sich plötzlich mit einem Korrektiv konfrontiert, das ihnen aus dem Internet erwuchs: Open Review hieß das neue, webbasierte Werkzeug einer globalen wissenschaftlichen Qualitätskontrolle. Als 2014 Zweifel an einer japanischen Stammzellenstudie aufkamen, versuchten Forscher aus aller Welt, den Erfolg zu reproduzieren. Eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um unsaubere Arbeit und mutmaßliche Manipulation spielte ResearchGate: Die Berliner hatten die Open-Review-Offensive mit einer eigenen Onlineplattform maßgeblich vorangetrieben.
„Mittlerweile nutzt die Wissenschaftsszene ResearchGate sehr aktiv“, konstatiert Ijad Madisch, in den vergangenen acht Jahren habe sich ein Mentalitätswandel vollzogen. „Den Forschern wird immer klarer: Sie werden erfolgreicher, wenn sie offener sind – und mehr öffentlich machen.“ Von einem solchen Wandel zeugt auch das Wachstum des Netzwerks: Knapp 300 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile in der Hauptstadt sowie am Firmensitz in Boston. Außen ein repräsentativer Gründerzeitbau, prägen innen die Insignien der digitalen Gründerszene das Klima: Es gibt den obligatorischen Tischkicker und einen Billardtisch, ein modernes Lounge-Ambiente statt strenger Büroatmosphäre. Und es gibt obendrauf sendungsbewusst-selbstbewusste Rhetorik, die sich wohl jeder Start-up-Gründer aneignet, um Investoren zu überzeugen: „ResearchGate“, sagt Madisch, „verändert insgesamt die Art und Weise, wie wir Forschung machen.“
„ResearchGate verändert insgesamt die Art und Weise, wie wir Forschung machen.“

Auch Fehlschläge sind für die Community interessant
Dafür wagt die Onlineplattform – nach Open Access und Open Review – nun einen weiteren Schritt in Richtung Open Science: Seit März können Wissenschaftler über ein neues Feature der Plattform in Echtzeit zusammenarbeiten. Forschung von Anfang bis Ende zu teilen, von den ersten Rohdaten über negative Ergebnisse bis hin zum fertigen Paper – diese Idee will Projects vorantreiben. Wenn ein Wissenschaftler einen Artikel publiziere, „dann sind das vielleicht fünf Prozent von dem, was er wirklich gemacht hat. Die anderen 95 Prozent verschwinden irgendwo im Orkus. Wir wollen, dass auch diese 95 Prozent öffentlich gemacht werden können“, sagt Madisch.
Wissenschaftler müssten mit einem irgendwo schon einmal gescheiterten Forschungsansatz gar nicht erst beginnen und Fehler von Kollegen nicht noch einmal machen; sie könnten zudem bereits erhobene Daten nutzen. Eine Diskussion über Fehlschläge könne dank Projects früher ansetzen, die Offenheit Forschern neue Perspektiven aus anderen Forschungsfeldern und Disziplinen eröffnen. ResearchGate könne Ijad Madisch zufolge die Wissenschaft so insgesamt schneller und effizienter machen.
Doch Madischs Utopie, Forschung live „für alle zu öffnen“, stößt auch auf Kritik. So wurden Zweifel daran laut, dass sich – im derzeitigen Wettbewerb eines schnellen publish or perish – Wissenschaftler bereits in einem frühen Stadium ihrer Forschung in die Karten schauen lassen würden. „Dass unsere Plattform Realtime ist, ist dafür die Lösung – und nicht das Problem“, kontert Ijad Madisch diesen Einwand. Gewänne ein Forscher eine neue Erkenntnis, so wolle er diese doch möglichst schnell an die Öffentlichkeit bringen, „weil ich Angst habe, dass es sonst jemand anderes tut.“ Mit neuen digitalen Metriken ermögliche ResearchGate nicht nur, nachzuvollziehen, wer Erster war; Wissenschaftler, sagt Madisch, könnten so auch schon in einem früheren Forschungsstadium Reputation für ihre Arbeit bekommen.
Könnte sich ResearchGate auf lange Sicht zu einer Art Monopolist für wissenschaftliche Informationen entwickeln – und letztlich das herkömmliche Publikationssystem ersetzen? Madisch wischt solch spekulative Gedanken vehement beiseite. Der Mann mit dem Superman-Cap mag selbstbewusst sein, er gibt sich aber nicht größenwahnsinnig. Journals werde es auch weiterhin geben, betont Ijad Madisch, ResearchGate decke ein anderes Spektrum der Wissenschaft ab. „Ich sehe uns immer noch als Zusatz zu dem aktuellen System.“