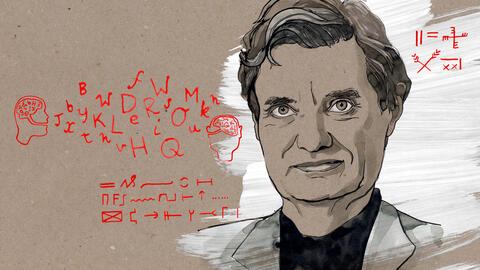Zu Beginn des 2. Aktes von Faust II beschimpft der Bakkalaureus seinen Professor (das ist der verkleidete Mephisto) mit sehr groben Worten. Auf seine Unhöflichkeit angesprochen, sagt er den berühmten Satz „Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist.“ Es ist ein alter Traum, an der Sprache selbst (und nicht wie beim Lügendetektor an allerhand Köperreaktionen beim Sprechen) zu erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt. Man wird ihn noch eine Weile träumen, aber es gibt Fälle, in denen man dem ganz nahe kommt, zum Beispiel bei der Verwendung des Konjunktivs.
Konjunktiv und Wahrheit in der Redewiedergabe
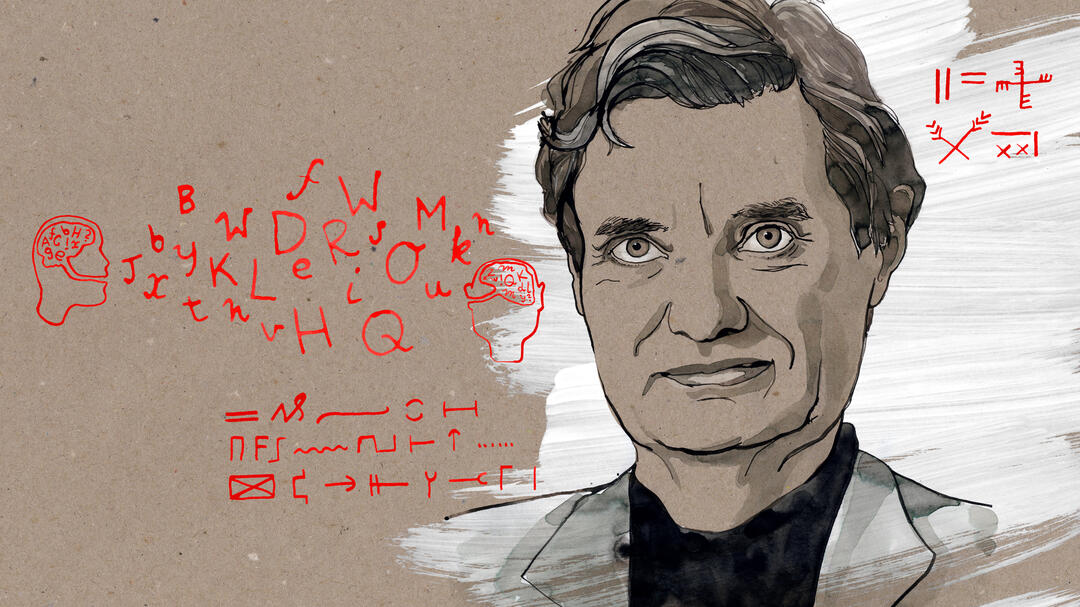
Faktive Verben. Dazu gehören entschuldigen, vergessen, verstehen, wissen. Wenn jemand sagt Sie entschuldigt, dass er singt, dann singt er nach Meinung des Sprechers tatsächlich. Der Nebensatz ist nach Meinung des Sprechers wahr. Ob er tatsächlich wahr ist, bleibt natürlich offen. Es geht ausschließlich um Sprachliches, insofern man sagen kann: Die Wahrheit wird vom Sprecher unterstellt, anderenfalls kann er den Satz nicht äußern. Beim normalen Sprechen zeigt der Sprecher, was er denkt, ob ihm das klar ist oder nicht. Solche Verben heißen seit ihrer ersten Beschreibung durch die amerikanischen Linguisten Carol und Paul Kiparsky in den 70er Jahren faktiv. Faktive Verben erzwingen den Indikativ, ein Satz wie Sie vergisst, dass er singe ist in der vorausgesetzten Bedeutung ungrammatisch.
Nichtfaktive Verben. Zur Gegengruppe gehören behaupten, glauben, hoffen, meinen. Wer äußert Sie behauptet, dass er singe lässt offen, was er selbst darüber denkt. Daran ändert auch der Indikativ nichts: Sie behauptet, dass er singt spricht nur über eine Behauptung. Bei den nichtfaktiven Verben kann sowohl der Konjunktiv als auch der Indikativ stehen. Einen Bedeutungsunterschied gibt es nicht.
Faktive/nichtfaktive Verben. Zu den Verben, die beide Bedeutungen haben können, gehören berichten, erzählen, mitteilen, sagen. Bei ihnen signalisiert der Indikativ Faktivität: Sie berichtet, dass er singt besagt, dass er nach Meinung des Sprechers tatsächlich singt. Sie berichtet, dass er singe lässt wieder offen, was der Sprecher denkt. Bei diesen Verben brauchen wir die Unterscheidung von Indikativ und Konjunktiv, um auszudrücken, ob der Nebensatz für wahr gehalten wird oder nicht.
„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine natürliche Sprache wie das Deutsche überflüssige Formen in größerer Zahl enthält. “
Was besagt nun die normative Konjunktivregel angesichts dieser Faktenlage? Bezüglich der ersten Gruppe von Verben muss sie passen. Sie weiß nicht, warum sie nicht anwendbar ist. Bezüglich der zweiten Gruppe läuft sie leer. Sie erzwingt den Konjunktiv sozusagen rein stilistisch und ohne semantischen Effekt. Bei der dritten Gruppe beschneidet sie die Ausdruckskraft der Sprache. Es hat ja seinen guten Grund, ob jemand hier den Indikativ oder den Konjunktiv verwendet, man darf ihm deshalb auf keinen Fall den Indikativ verbieten.
Der oben zitierte, sehr verbreitete Typ von grammatischer Regel taugt nicht viel. Man sollte an die Stelle einer Normaussage zur grammatischen Form immer den Versuch setzen, das Verhältnis von Form und Funktion zu verstehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine natürliche Sprache wie das Deutsche überflüssige Formen in größerer Zahl enthält.