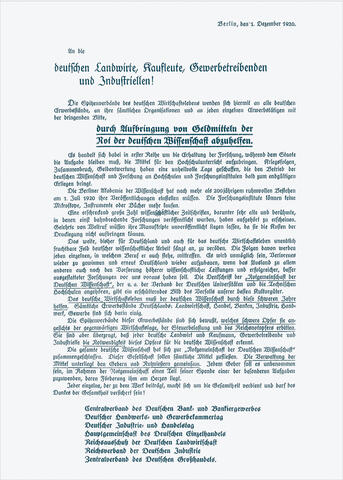Preußen war der erste Staat in Europa mit einem Kultusministerium. Es wurde 1817 eingerichtet und verfügte über eine ganz ungewöhnliche Kontinuität hervorragender Kultusminister oder leitender Ministerialbeamter, von Wilhelm von Humboldt und Karl vom Stein zum Altenstein über Johannes Schulze und Friedrich Althoff bis hin zu Carl Heinrich Becker. In diese Reihe gehört der letzte königlich-preußische Kultusminister Friedrich Schmidt-Ott, der mit seinen Ideen und seiner Energie 1920 die Gründung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (NDW) und des Stifterverbandes der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft vorbereitet und durchgesetzt hatte. Friedrich Schmidt-Ott (1860–1956) war noch von der preußischen Idee durchdrungen, den Rechtsstaat als sorgsamen Hüter und Förderer der geistigen Freiheit zum Kulturstaat zu erweitern. Preußen war nicht, wie dessen Verächter dauernd verkündeten, ein Reich der Kasernen und Truppenübungsplätze, sondern auch und vor allem ein Land der Schulen, Akademien, Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstitute.
Stifterverband
Friedrich Schmidt-Ott: Ein autokratischer Diplomat

Friedrich Schmidt-Ott war einer der einflussreichsten Wissenschaftsorganisatoren des 20. Jahrhunderts. Die Gründung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und des dazugehörigen Stifterverbandes im Jahr 1920 gehen auf seine Initiative zurück. Mit einer Mischung aus Ideenreichtum, Selbstherrlichkeit und Vermittlungsgeschick gelang es ihm in der Folge, die darbende deutsche Wissenschaft zu beleben. Eine Würdigung anlässlich des 100. Geburtstages des Stifterverbandes.
Diese drei Freiheiten waren unmittelbar mit der Bildungsidee eines selbstständigen, freien Menschen verbunden, der in der Verwaltung jeder Aufgabe mit Zartheit und Behutsamkeit gegenüber allem Lebendigen gewachsen ist. Die Universitäten unterhielt zwar der Staat, aber er garantierte auch diesen Körperschaften eigenen Rechts ihre Selbstständigkeit. Professoren, Priester und Richter veranschaulichten mit ihren Talaren den besonderen Rang der freien Universität, der freien Kirche und der freien Gerichte im freien Staat.
Solche Ideen waren Friedrich Schmidt-Ott von zu Hause her vertraut, denn sein Vater war ein kulturprotestantischer Beamter im Dienst des Staates und der Kirche, geprägt von den humanistischen Verpflichtungen, ein umfassend gebildeter Mensch zu werden, den der Akademiker als Stand repräsentieren sollte. Er trat im Oktober 1888 in das preußische Kultusministerium ein, das er im November 1918 nach einer außergewöhnlichen Laufbahn bis zum Kultusminister verließ.
„Kollege Schmidt, jetzt gehen wir nach Hause.“
In seinen Lebenserinnerungen beschreibt Friedrich Schmidt-Ott seinen Vorgesetzten Friedrich Althoff:
„Er kam unregelmäßig aufs Ministerium, da er schon vorher allerlei Besuche an anderen Stellen oder auf der Straße erledigte. Wenn er einem wichtigeren Bekannten begegnete, holte er nicht selten einen Zettel aus der Tasche, auf dem er seine Fragen und Wünsche an den Betreffenden bereits notiert hatte. Vom Tage meines Eintritts an wünschte er, mit mir nach Hause zu gehen, was meine Heimkehr völlig unregelmäßig machte und auf eine späte Nachmittagsstunde verschob. Wir schlenderten unter wichtigen Gesprächen durch den Tiergarten nach der Friedrich-Wilhelm-Straße, wo er wohnte, und ich kam erst dann nach unserer Wohnung in der Genthiner Straße zurück, wo die liebevolle Mutter mich zu meinem späten Mittagsmahl erwartete. Diese Gepflogenheit gemeinsamen Heimgehens haben wir ständig festgehalten. Sie änderte sich, als er Anfang der 90er-Jahre nach Steglitz verzog insofern, als wir uns am Potsdamer Bahnhof in Berlin und, nachdem ich 1903 selbst nach Steglitz hinausgezogen war, frühestens am Bahnhof Steglitz trennten. Ein witziger Kollege, der in einem auf Frau Althoffs Veranlassung herausgegebenen Schriftchen Althoffs Tageslauf schildert, beendet ihn bezeichnenderweise mit den Worten: „Kollege Schmidt, jetzt gehen wir nach Hause.“ (aus: Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950)
Der ihm übergeordnete Beamte Friedrich Althoff erkannte sofort die vielversprechenden Talente des jungen Mannes, den er als Kollege und väterlicher Freund besonders förderte. Friedrich Schmidt-Ott wurde seinem „Napoléon der Wissenschaftspolitik“, wie Wilhelm II. Friedrich Althoff nannte, bald unentbehrlich. Diesen in alle Gebiete der Wissenschaft eingreifenden Mann hielt der Staatsrechtler John William Burgess von der New Yorker Columbia-Universität für einen „der bedeutendsten Männer der Welt“. Als solcher war er unvermeidlich unter Professoren sehr umstritten. Da ursprünglich selbst Professor, war er vertraut mit den Schwächen und Eitelkeiten der Professoren, die zuweilen die großen Zusammenhänge aus den Augen verloren.
Friedrich Althoff wollte gerade eigenwillige Verabsolutierung von Denkschulen und gelehrten Richtungen unterbinden und die Macht der zu ihnen gehörenden Klüngel und Cliquen schwächen. Ihn interessierte allein die Sache und alles, was ihm erforderlich zu sein schien, um deutsche Universitäten und der deutschen Wissenschaft ihre Überlegenheit zu erhalten. Das bedeutete, die überlieferte Idee der Universität, ohne sie zu aufzugeben, den neuen Herausforderungen anzupassen, also auch die Wissenschaft wie einen Großbetrieb zu organisieren, ohne dabei die Einheit der Wissenschaften zu vernachlässigen, auf die der Name Universität hinweist. Friedrich Althoff setzte sich deshalb dafür ein, die Förderung der Wissenschaften und Forschung nicht mehr als eine rein staatliche Aufgabe, sondern vielmehr als gesellschaftliche Pflicht zu betrachten und gerade die Wirtschaft, die auf die Wissenschaft angewiesen war, dafür zu gewinnen, sich an der Einrichtung von Forschungsinstituten außerhalb der Universität zu beteiligen.
„Die französische Universität hat keine Freiheit, die englische keine Wissenschaft, die deutsche Universität hat beides.“

Friedrich Schmidt-Ott war sein engster Mitarbeiter bei der Planung der Kaiser-Wilhelm-Institute in Berlin-Dahlem und der Vollstrecker der Ideen Althoffs nach dessen Tod 1908. Der preußische Staat gab die Grundstücke und bezahlte den Direktor, Stifter und Unternehmer sollten die weiteren Kosten übernehmen. Sie ließen sich ab 1910 bereitwillig darauf ein, längst davon überzeugt, Forschung und Wissenschaft als eine Gemeinschaftsaufgabe aller Deutschen zu verstehen, die dem Reich als Kulturstaat mit ihren Leistungen und ihrer Fantasie neue Möglichkeiten erschlossen. Die Max-Planck-Institute stehen in der Tradition dieser Gründung, die keine preußische mehr war, obwohl im preußischen Kultusministerium ersonnen, sondern eine gesamtdeutsche. Unter dem Eindruck der Ideen Friedrich Althoffs lernte der preußische Beamte Schmidt-Ott, sich als Kulturpolitiker nicht von den regionalen Interessen leiten zu lassen, sondern gesamtdeutsch zu denken, um im wissenschaftlichen Großbetrieb erfolgreich wirken zu können.
„Daß die Welt an netten jungen Mädchen nicht arm war, will ich nicht leugnen.“
Bei einem Kurzurlaub in der Schweiz begegnet der 34-Jährige Junggeselle Schmidt seiner späteren Frau Meta Ott:
„Das Jahr 1894 war für mich von besonderer Bedeutung, weil es mich meinem Lebensglück zuführte. Ich hatte es bei meiner Mutter im Hause herrlich gut. Da ich aber mit der Zeit das 34. Lebensjahr erreichte, fehlte es nicht an Versuchen, mir zu einer Frau zu verhelfen. Daß die Welt an netten jungen Mädchen nicht arm war, will ich nicht leugnen. (...) Unser Aufenthalt in Wengen sollte nur drei Tage dauern, wurde aber durch eine Unpäßlichkeit meines Kollegen auf zehn verlängert. Hier lernte ich mit dem feinsinnigen Maler Ott-Daeniker aus Zürich dessen beide Töchter Marie und Meta kennen, von denen die letztere mein wie meiner Eltern ganzes Herz gewann. Nach täglichem Zusammensein und mehrfachen Ausflügen, namentlich nach dem Lauberhorn, auf denen wir plauderten und sangen, wagte ich am 27., dem Tage vor meiner Abreise, bei der Heimkehr von einem Spaziergang die entscheidende Frage an das geliebte Mädchen, die auf keine Absage stieß. Als ich aber ihrer Weisung gemäß nach der üblichen Abendandacht in der Kapelle des Hotels an ihren Vater herantrat, erwiderte er, von der Verlobung mit seiner Tochter könne keine Rede sein, und er erläuterte dies auf meine Anfrage dahin, daß er mich ja gar nicht kenne. Ich erfuhr erst später, daß er, nachdem bereits zwei Töchter in Deutschland verheiratet waren, seine Tochter besonders vor der Verheiratung mit einem Deutschen gewarnt hatte. Nach längerer Aussprache erklärte er sich mit einem Briefwechsel zwischen uns beiden einverstanden.“ (aus: Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950)
Vorzüge der Autorität
Friedrich Schmidt-Ott war zu Lebzeiten seines Freundes und Vorbildes auch für die künstlerischen Einrichtungen zuständig, wobei er als musikalischer Bildungsbürger sich besonders der Musik annahm und für die Etablierung der neuen Musikwissenschaften an den Universitäten sorgte. Im Einverständnis mit Wilhelm II., dessen Schulkamerad er in Kassel gewesen war, nahm er die Pflege der Volksmusik ernst und sah in den regelmäßigen Sängerfesten der Gesangsvereine in Anwesenheit des Kaisers eine Gelegenheit, den Kulturstaat und den Sozialstaat einander anzunähern. Von Friedrich Althoff, einem sehr nonchalanten Beamten, lernte er auch, dass schwierige Gespräche am besten während längerer Spaziergänge im Tiergarten oder auf und ab gehend Unter den Linden geführt werden können. Überhaupt spielte Geselligkeit eine große Rolle unter Kollegen, mit Professoren und Bankiers oder Unternehmern, um sie für Stiftungen zu gewinnen oder ihre Aufmerksamkeit für bestimmte Zwecke zu wecken.
Er wurde zum Diplomaten, aber auch, darin seinem Lehrer und Vorbild Althoff ähnlich, zum Autokraten, davon überzeugt, dass ein Einzelner mehr erreichen kann als ein Gremium oder Ausschuss. Dort vergeht die meiste Zeit damit, Kompromisse zu finden, um unterschiedliche Temperamente und Gesichtspunkte miteinander in ein prekäres Gleichgewicht zu bringen. Da seine ausschweifende Sachkenntnis wie bei Friedrich Althoff unweigerlich Eindruck machte, erkannten viele auch die Vorzüge der Autorität im Vergleich zu demokratischer Diskussion. Unmittelbar nach dem Krieg und während der ersten sehr unsicheren Jahre in der Republik ab 1918 fügten sich Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer dankbar dem leidenschaftlichen Werben dieses erfahrenen Kulturbeamten, Reich, Länder und gesellschaftliche Kräfte zu gemeinsamen Anstrengungen zu veranlassen, um die Wissenschaft in Zeiten der Inflation und – abgeschnitten vom Ausland – vor ihrem Zusammenbruch zu bewahren. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft – heute Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – und der Stifterverband entstanden 1920 unter Friedrich Schmidt-Otts Druck und Überredungsgabe. Beide Organisationen haben sich erhalten, weil sie sich bewährten.
„Unterdessen erwuchs mir in der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft eine große und vielleicht die schönste Aufgabe meines Lebens.“
, via Wikimedia Commons Friedrich Schmidt-Ott um 1917 (Foto: gemeinfrei/Nicola Perscheid: [Friedrich Schmidt-Ott c1917]( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_Schmidt-Ott_c1917.jpg), via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/1320x1030/public/friedrich_schmidt-ott_c1917_quadrat.jpg?itok=Nm4zf_92)
Der preußische Beamte und Mann des Staates war von Althoff dazu erzogen worden, um Preußen und die anderen Staaten zu entlasten, die Zusammenarbeit mit privaten Interessenten zu suchen, aber auch mit dem übergeordneten Reich. Es gab gerade in den Reichsministerien Beamte, die die Notgemeinschaft als Mittel verstanden, um in Konkurrenz zur Kulturpolitik der Länder dem Reich überhaupt eine bedeutende, größere Mitsprache im kulturellen Leben zu sichern. Solche Tendenzen konnte Schmidt-Ott erfolgreich abwehren, obschon er die Wissenschaft als deutsche Aufgabe verstand, für die unter den ungünstigen Umständen der Zeit Befangenheit in kleinstaatlichem Denken nur schädlich sein konnte. Mit ungemeinem Geschick vermittelte er zwischen Zentralisten und Föderalisten, auch zwischen Parteipolitikern, Professoren und Beamten und vernachlässigte keineswegs seine alten Verbindungen zu Industriellen im Stifterverband.
„Abwärts pflegte ich sie in schnellem Trabe zu erledigen.“

Im Berliner Schloss fand die Notgemeinschaft ihre ersten Büroräume. Die dortigen Anfänge beschrieb Schmidt-Ott so:
„Nach vorübergehender Benutzung des zu meiner Verfügung stehenden Roosevelt-Zimmers der Staatsbibliothek gelang es mir, eine Reihe von Räumen im zweiten Stock des Schlosses, südlich vom Eosanderportal, zu gewinnen. Dort lag mein Zimmer zunächst dem Eingang, neben denen der Kollegen Schwoerer und Siegismund, mit denen ich in jederzeitigem Austausch über die uns bewegenden Fragen stand. Anschließend die übrigen Räume. Die mehr als achtzig Stufen zählende Wendeltreppe bot nicht gerade bequemen Aufstieg. Abwärts pflegte ich sie in schnellem Trabe zu erledigen. Der einzige Aufzug des Schlosses, der seinerzeit für die herzleidende Kaiserin eingebaut war, wurde erst nach längerer Zeit zu unserer Benutzung freigegeben. Dem lebhaften Besucherverkehr in der Notgemeinschaft bot diese Lage kein Hindernis. Der große Kinderspielsaal der kaiserlichen Prinzen gab sogar die Möglichkeit, wenigstens gelegentlich, einen Parlamentarischen Abend zu veranstalten, jederzeit aber Sitzungen des Hauptausschusses und Sitzungen unserer Ausschüsse und Kommissionen darin abzuhalten.“ (aus: Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950)
Mithilfe der beiden Gemeinschaften gelang ihm das Wichtigste: dem Nachwuchs eine Zukunft zu eröffnen über Forschungsstipendien und Reisestipendien, um die unterbrochenen Beziehungen zum Ausland wiederzubeleben, und Druckkostenzuschüsse. Diese gar nicht spektakulären Maßnahmen bewahrten tatsächlich die Wissenschaft davor, zusammenzubrechen. Es gab immer wieder Kritik an seiner Selbstherrlichkeit, doch auch heftige Gegner anerkannten, dass er immer sachlich blieb, sich von keinem instrumentalisieren ließ, Moden zu folgen, sondern souverän möglichst viele dafür gewann, in seinem Sinne die Lage der Wissenschaftler und der Wissenschaft zu stabilisieren. Nach der „nationalen Revolution“ 1933 meinten die jungen Nationalsozialisten, auf den Rat des Alten, der aus veralteten und zu überwindenden Zeiten stammte, verzichten zu können. Doch Friedrich Schmidt-Ott wollte sich keineswegs in das Privatleben zurückziehen und übernahm 1935 den Vorsitz im Stifterverband. Das erlaubte ihm, ohne Rücksicht auf die dauernd veränderten nationalsozialistischen Organisationen der Wissenschaftsförderung, weiterhin einen gewissen Einfluss wahrzunehmen, nicht zuletzt über seine persönlichen Beziehungen und Verbindungen.
Nach dem Zusammenbruch 1945 konnten frühere Mitarbeiter die Wissenschaftsförderung in seinem Sinne modifiziert wieder aufbauen, was er noch erlebte. Über seine Person gab es in der Bundesrepublik, die kaum an Traditionen anknüpfen konnte und wollte, zumindest in der Wissenschaftspolitik eine Kontinuität, die weit hinabreichte in das indessen aufgelöste Preußen. Diese Kontinuität veranschaulichte Seine Exzellenz, der greise Friedrich Schmidt-Ott, der als Ehrenpräsident der DFG dem Stifterverband weiterhin verbunden war.
---
Eberhard Straub ist Historiker und Publizist. Seine bekanntesten Werke beschäftigen sich mit den Wittelsbachern, dem Hamburger Reeder Albert Ballin oder der Geschichte Preußens. Von 1991 bis 1997 war Straub Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Stifterverbandes.
Die obigen Textauszüge stammen aus dem Buch: Friedrich Schmidt-Ott: Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1952.
100 Jahre Stifterverband
2020 feiert der Stifterverband Jubiläum. Begeben Sie sich hier auf MERTON gemeinsam mit uns auf Expedition durch 100 Jahre Stifterverband - von der Vermessung des Atlantiks über die wiederaufgebauten Hochschulen und Forschungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste und die wiedervereinte Wissenschaftslandschaft bis hin zum digitalen Bildungsneuland.
Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Veranstaltungen finden Sie auch unter www.stifterverband2020.de