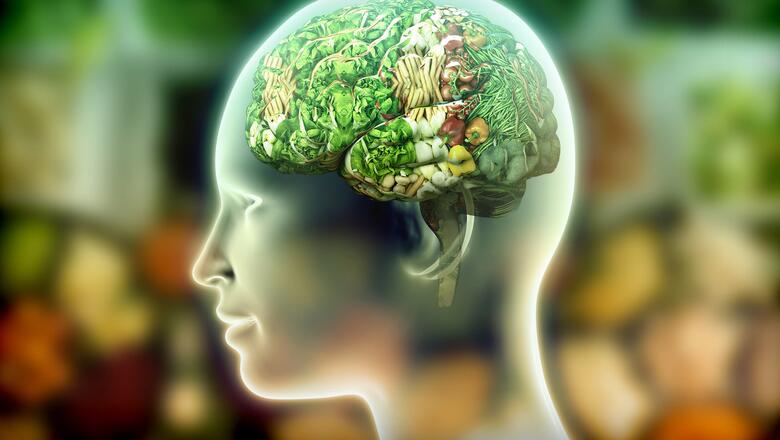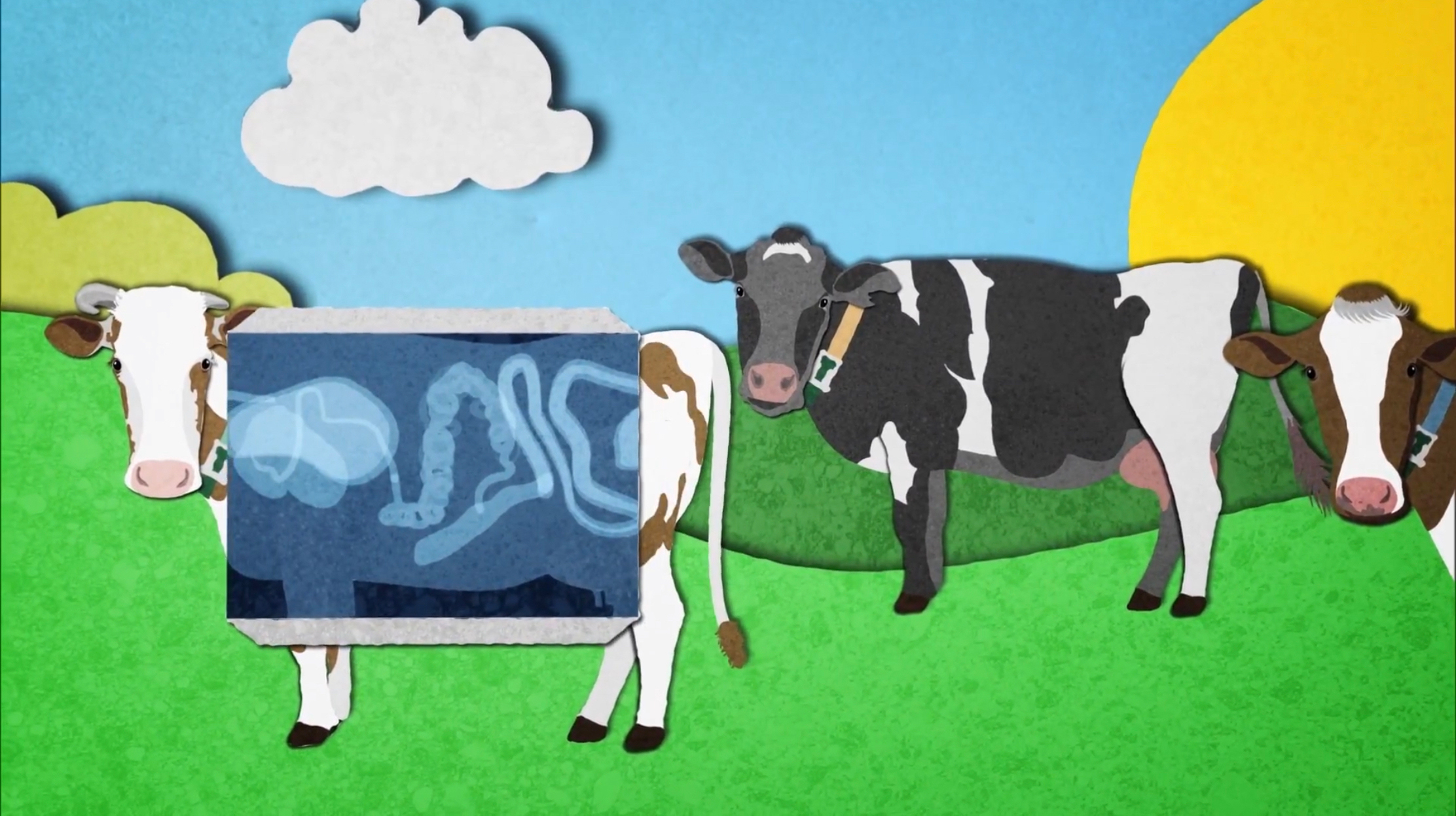In Kuh Uschi steigt die Temperatur, meldet der Sensor in ihrem Vormagen. Milchfieber? Der Hofreporter schaut nach: Entwarnung! Uschi grast bloß in der prallen Sonne. Tausende verfolgten ihr Sonnenbad im September 2017 an Smartphones oder Computern live. Uschi lebt auf einem Biohof und war Protagonistin im Sensorjournalismusprojekt „Superkühe“ vom WDR. Mit Kuh Emma von einem Familienhof und Kuh Connie aus einem Großbetrieb stand sie 30 Tage lang unter Beobachtung. Welche der drei Kühe lebt am gesündesten? Das wollte das Superkühe-Team herausfinden und ließ den Pansen-ph-Wert und die Temperatur im Vormagen der Tiere mit einem in der vernetzten Landwirtschaft gängigen Sensor messen.
Superkühe und enttarnte Geheimdienstler

Bei „Superkühe“ ging es im Kern um eine kontrovers diskutierte Frage der modernen Landwirtschaft: Bezahlen Kühe eine billigere Milchproduktion mit ihrer Gesundheit? Die Idee, hierzu Kühe selbst „sprechen“ zu lassen, eröffnete den Wissenschaftsjournalisten neue Dimensionen. „Wir hatten bei ‚Superkühe‘ die Chance, mit einem Prototyp rauszugehen, und konnten schauen, welche Geschichten sich dabei ergeben“, so Jakob Vicari. Die Sensordaten gaben der Liveberichterstattung Rückendeckung. „Wir konnten jederzeit sagen: Schaut her, wir berichten wahr und richtig, hier sind die Daten, seht sie euch an.“
Eine neue Offenheit an der Schnittstelle Wissenschaft und Journalismus tut deshalb dringend not. Nicht nur, weil seriöse Forscher zunehmend ein Glaubwürdigkeitsproblem durch Verschwörungstheorien bekommen. Fakt ist auch: Auf den Wissenschaftsjournalismus rollt eine Welle zu, die klassische Medienformate schon bald recht alt aussehen lassen könnte: das Internet der Dinge. Wissenschaftler sollten den Journalisten deshalb langfristig gerade bei der aufwendigen Datenanalyse zur Seite stehen, denn der Aufwand des Sensorjournalismus ist enorm. Offenere Kooperationen könnten also beiden Seiten helfen.
Journalismus trifft auf das Internet der Dinge
Näheres erfuhren Journalisten im November 2019 in Stuttgart auf der ersten deutschen „Journalism of Things Conference“, die Jakob Vicari mit Hendrik Lehmann vom Tagesspiegel Berlin und Jan Georg Plavec von der Stuttgarter Zeitung ins Leben rief, ebenfalls Pioniere im deutschen Sensorjournalismus. Hauptredner John Mills ließ die Katze bei Tagungsbeginn sofort aus dem Sack und zitierte Mark Walport: „Das Internet der Dinge hat das Potenzial, die Gesellschaft stärker zu beeinflussen als die erste digitale Revolution.“ Walport ist Professor für Medizin und Generaldirektor der UK Research and Innovation, die öffentliche Fördergelder für Forschung und Innovation vergibt.
Der Journalismus darf die Technologien für das eigene Tun nicht ausblenden, denn er wird an zwei Fronten herausgefordert: Die klassischen Medienkanäle bekommen enorme Konkurrenz, da zukünftig nahezu jedes Ding ein Ausspielkanal werden kann. Parallel sammeln zukünftig alle möglichen Akteure, allen voran Google und Apple, aber auch Unternehmen wie Bosch, mit ihren Technologien und Dingen Daten, mit denen sie Geschichten auf neue Weise erzählen können und werden: dialogischer, erlebbarer, in Echtzeit. Das wird die Mediengewohnheiten der Bürger prägen und formen. Wer Inhalte kreiert, müsse deshalb auch die Fähigkeit lernen, damit in Echtzeit mit Menschen in den Dialog zu gehen, riet Podiumsredner Michael Schmidtke, der die Digitale Kommunikation bei Bosch leitet. Das Publishing, wie wir es heute kennen, werde es zukünftig nicht mehr geben, glaubt Schmidtke.
Datenjournalismus
Bislang sind erst wenige Journalisten hierzulande auf das Internet der Dinge eingestellt: sowohl was die neuen Medieninterfaces angeht, über die journalistische Inhalte zukünftig präsentiert werden, als auch das Einsetzen vernetzter Gegenstände als Recherchequelle. Welcher journalistische Sprengsatz in diesen Quellen stecken kann, zeigt bereits das niederländische investigative Recherchenetzwerk „De Correspondent“, das über Daten von Fitness-Apps geheime Militärcamps und reihenweise sogar die Identität und selbst den Wohnort von Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern identifizierte – einfach über deren tägliche Joggingrouten.
Dieses Beispiel zeigt, wie leicht Journalisten Daten aus dem Internet der Dinge nutzen können. Allein darüber, dass Datenlecks dort noch überall an den Schnittstellen zwischen Ding und Internet existieren, ließe sich fortwährend berichten und aufklären. Die Geschichten liegen aber auch anderswo „auf der Straße“: in den Open-Source-Datenbanken der Wissenschaft, die immer zahlreicher werden. Die vom deutschen Max Planck Institut of Animal Behavior betreute Movebank ist hier wohl das eindrücklichste Beispiel: Millionen Daten von mit Sensoren versehenen Wildtieren und Zugvögeln sind dort zugänglich.
Manchmal ist es auch andersherum – da liefert der Sensorjournalismus plötzlich wissenschaftliche Daten, wie beim Projekt „Blast Tracker“. Ziel war es, Dynamitfischern in Tansania mithilfe von vor den Küsten im Meer platzierten Sensoren auf die Spur zu kommen. Am Ende zeichneten die Geräte aber auch seltene Gesänge und Geräusche von Delfinen und anderen Meeressäugern auf – ein unerwarteter Nebeneffekt.
Und wie war das am Ende mit der gesündesten Kuh? Biohof? Die stabilsten Datenkurven hatte Connie, die Kuh im Großbetrieb: bestens mit allem versorgt, zu jeder Zeit. Uschi dagegen musste zum Saufen auf der Weide einen Hügel hoch und beschränkte sich vielleicht deshalb auf zwei Sauftouren pro Tag – aus tiermedizinischer Sicht nicht ganz so optimal.