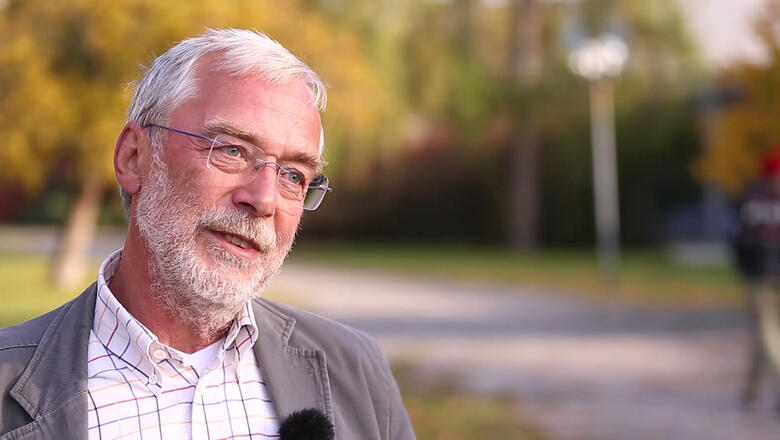Technologiesprünge verändern unser Leben, sie ermöglichen oder zwingen uns, anders zu arbeiten. Nach dem Krieg war knapp die Hälfte der Deutschen in der Landwirtschaft tätig, heute sind es weniger als zwei Prozent, und auch diese wenigen produzieren noch zu viel Milch. Die Landarbeit wurde damals durch den Trecker revolutioniert, es stiegen die Produktionszahlen der Autos, unzählige Kilometer Autobahn wurden gebaut, und der Tourismus blühte auf. Die früheren Landarbeiter bauten also Straßen, Autos und Hotels, sie schulten um. Ihre Arbeit war nun zumeist besser als zuvor, wo sie im vorwinterlichen Nieselregen hatten Rüben roden müssen. Deutschland erlebte ein Wirtschaftswunder.
Nach dem Trecker kommt der Computer – das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Und wieder wird sich die Hälfte von uns einen neuen Job suchen müssen. Verschwinden wird all das, was per Bits und Bytes erledigt werden kann. Welche Jobs das konkret sind, ist schwer vorherzusagen. Nur ein Beispiel für das Wegbrechen von Arbeitsplätzen: Wenn man den Privatbesitz von Autos verbietet und ein System von selbstfahrenden Vehikeln aufzieht, das uns wie im Schlaraffenland auf Bedarf hin und her fährt – dann ist schon vielleicht ein Drittel der Arbeitsplätze verloren. Konkret könnte es schon bald so aussehen: Wir haben eine Taxi-App auf dem Smartphone: „Fahr mich zur Arbeit“ – „Jetzt zum Discounter“ – „Jetzt zum Gletscher, danach zum Absacker in die Disco!“ Jeder von uns bekommt 24.000 Taxi-Kilometer pro Jahr kostenlos vom Staat. Der Clou ist: Alle heutigen Autos parken fast rund um die Uhr, sie werden vielleicht in fünf Prozent der Zeit genutzt. Die selbstfahrenden Taxis fahren dagegen möglichst immer, vielleicht schafft man es, sie 30 bis 40 Prozent der Zeit unterwegs sein zu lassen – nicht mehr, denn man braucht ja eine Reserve für die Stoßzeiten.
Was von der Arbeitswelt übrig bleibt


Ganze Berufe gehen verloren
Nach Adam Riese wird also künftig nur ein Sechstel bis ein Achtel der Autos von heute benötigt und viel weniger Lastwagen, weil sie ja ohne Fahrer nicht dauernd Pause an der Autobahn machen müssen. Wir brauchen dann also keine Lkw-Fahrer mehr, keine Taxifahrer, keine Parkhäuser, keine Verkehrspolizisten, Radarfallen und so weiter. Bekanntlich arbeitet heute fast ein Drittel der Deutschen direkt oder mittelbar für die Automobilindustrie. Das ist die Größenordnung, um die es bei der Veränderung geht.
Das ist aber noch der einfache Teil. Schauen wir auf die Berufe, die uns erhalten bleiben. Von denen entfällt dann jeweils der Teil, den Computer erledigen können. Der Automechaniker war Virtuose im Aufspüren der Probleme. Schon heute fragt man das Auto elektronisch nach einem Fehlercode ab. Warum sollte das nicht auch bei Menschen mit elektronischer Uhr am Handgelenk so gehen, wenn sie krank sind? Müssen sich Rechtsanwälte in Zukunft noch um Lappalien kümmern wie Kündigungen von Kreditkarten oder Handys? Braucht man Architekten, die mit der Hand zeichnen, wenn bald viele Grundrisse einfach im Internet stehen? Kann man Schulwissen nicht per YouTube erwerben, Sprachen direkt per Skype in anderen Ländern erlernen? Gibt es nicht bald alle Uni-Vorlesungen im Netz? Ich sehe schon die Gegner, die sagen: „Das geht nicht, nichts ist so gut wie das, was der Mensch macht.“ Damit gehen sie über die Tatsache hinweg, dass die Professionalität von digitalen Lösungen atemberaubend ansteigt. Das müssen wir einfach nüchtern hinnehmen – und wer es nicht glaubt, der schaue sich nur an, wie Amazon bei seiner Gründung vor zwei Jahrzehnten belächelt worden ist: „Lächerlich, das ist nur so eine Website, nichts weiter, absolut keine Substanz. Und die soll an der Börse teurer sein als Karstadt mit all den Innenstadtimmobilien?“
Es bleiben die komplexen Berufe
Bei den Berufen, die uns erhalten bleiben – so wie Arzt, Rechtsanwalt, Lehrer, Professor, Erzieher –, fällt der einfache Routineanteil weg. Es bleibt der schwierige Teil: Ärzte bleiben mit jenen Patienten allein, deren Beschwerden von keinem eindeutigen Fehlercode erfasst werden. Rechtsanwälte erhalten nur noch Mandate für komplexe Fälle. Vertriebsbeauftragte verhandeln nur noch individuelle Aufträge, sie nehmen nie mehr einfach nur Bestellungen entgegen. Lehrer und Professoren sollen coachen und erziehen, das reine Wissen gibt es im Netz. Also: Die Hälfte der Jobs fällt weg. In den verbleibenden Berufen bleibt nur der komplexe Teil übrig. Bei komplexen Arbeiten kommt es mehr denn je darauf an, gut zu sein. Simple Arbeiten werden fast nur noch per Mindestlohn honoriert.
„Die Hälfte der Jobs fällt weg. In den verbleibenden Berufen bleibt nur der komplexe Teil übrig.“

Die beiden letzten Punkte liefern eine Erklärung für die Schere zwischen Wohlhabenden und Prekären, die sich in unserer Gesellschaft seit längerer Zeit öffnet. Die mittleren Jobs verschwinden, sie werden halbautomatisiert. Briefträger oder Taxifahrer, Kassierer oder Verkäufer – das alles geht fast ungelernt. In anderen Berufen wie etwa bei Malern oder Gärtnern entwickelt sich eine Zweiteilung: Der Malermeister wird zum Innendesigner und bestellt dann nur noch jemanden zum Tapezieren. Der Gärtner wird zum Naturgestalter und schickt Leute zum Heckenschneiden. Auf der einen Seite steht also die schöpferische Seite eines Berufes, auf der anderen die ausführende, die sich aller Möglichkeiten der Technik bedient. Die ausführenden Arbeiten von der Warenausgabe bis zum Streichen sind kurz davor, voll und ganz industrialisiert zu werden. Die schöpferische Seite verlangt aber einige Meisterschaft.
Ich wurde einmal gefragt, was man bei der IBM können müsse, um gut zu verdienen. „Mit dem Komplexen angst- und unfallfrei jonglieren“, meinte ich – und dann, nach einer weiteren Aufforderung, etwas Seriöses zu sagen: „So etwas wird immer richtig gut bezahlt: Arbeit in international vernetzten Projekten in einem örtlich verstreuten Team aus verschiedenen Kulturen. Verhandeln mit Einkäufern, Managern, Projektleitern, Ingenieuren. Erstellen und Verkaufen von neuen Zukunftskonzepten in einem Klima, das Wandel eher ablehnt. Empathie für Kunden, Kommunikation auf vielen Kanälen. Sinn für Erfolg. Talent, Dinge voranzutreiben und andere dabei motivierend mitzunehmen.“ Da lachten die Fragenden eher und meinten, dies treffe vielleicht auf zehn bis zwanzig Prozent des Unternehmens zu, die anderen müssten ja wohl keine eierlegende Wollmilchsau sein. „Es muss auch Indianer geben, nicht nur Oberindianer.“ Ich seufzte. Das stimmt ja auch. Aber nur für heute. Die zehn bis zwanzig Prozent werden diejenigen sein, die gut bezahlt bleiben.
Unser Lernen braucht ein Upgrade
So ist die Lage. Nun müssen Schlüsse gezogen werden. Ich sehe nur diesen: Wir müssen besser werden, und zwar in vielen Beziehungen. Die Landarbeiter von damals sind Bauarbeiter oder Fließbandarbeiter geworden – das war Umlernen. Das hat man schon seit langer Zeit verstanden, es wird schon immer „Lernen lernen“ und „Lebenslanges Lernen“ gepredigt. Das greift nun aber zu kurz. Wir müssen nicht nur umlernen, sondern wir brauchen ein echtes Upgrade. Schauen Sie in Ihr Grundschulzeugnis. Oben stehen die Kopfnoten, die für Ordnung, Fleiß, Betragen und Mitarbeit vergeben wurden. Das waren früher die Voraussetzungen für Facharbeiter und Servicekräfte: Man brauchte ehrliche Untertanen, die auf Geheiß einer Führungskraft ihren treuen Dienst versahen. Akademiker gab es zu meiner Jugendzeit kaum, und diejenigen, die es gab, waren eben diese Führungspersönlichkeiten und die Wissenschaftler. Heute aber müssen zunehmend mehr von uns solche Führungseigenschaften besitzen, wenn wir etwas meisterlich hinbekommen wollen, was ein Computer nicht kann. Was also sollten wir lernen? Projekte leiten, Managen, Verhandeln, Verkaufen, Überzeugen, Probleme erkennen und beseitigen, andere gut zu verstehen und mit ihnen auszukommen, Durchsetzen, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin.
Und was passiert? Außer dem Lernen von Fakten und Zusammenhängen tut sich im Kindergarten, in der Schule und in der Universität nicht viel, oder? Man stopft uns mit Stoff und mit Übungen zum logischen Denken voll. Das ist nicht falsch – hard facts müssen sein. Aber die Zukunft des Menschen liegt eher in den sogenannten Soft Skills, die ja der Computer noch nicht hat. Die Schule hängt an den alten Kopfnoten fest. An der Universität werden soziale Kompetenzen nicht vermittelt. Und dann, vielleicht nach dem Doktor mit 29 Jahren, haben junge Menschen fast nichts mit Persönlichkeitsbildung zu tun gehabt – sie sollen aber am nächsten Tag beim Berufseinstieg schon ein runder Mensch sein! Früher gab es noch lange Berufseinführungsphasen, die hat die Wirtschaft gestrichen. Zu teuer. Im Grunde muss man heute das große Glück haben, dass die eigenen Eltern zu einer zukunftsweisenden Erziehung imstande sind; dass sie ihren Kindern all die Soft Skills vermitteln, die in der Arbeitswelt gefragt sind. Und weil das so ist, wütet die Presse gegen soziale Ungleichheit. Die ist allerdings nicht das Problem, sondern das zunehmende Versagen von Menschen aus dem alten Erziehungssystem, die als Kind den Gehorsam des Arbeiters eingebläut bekamen.