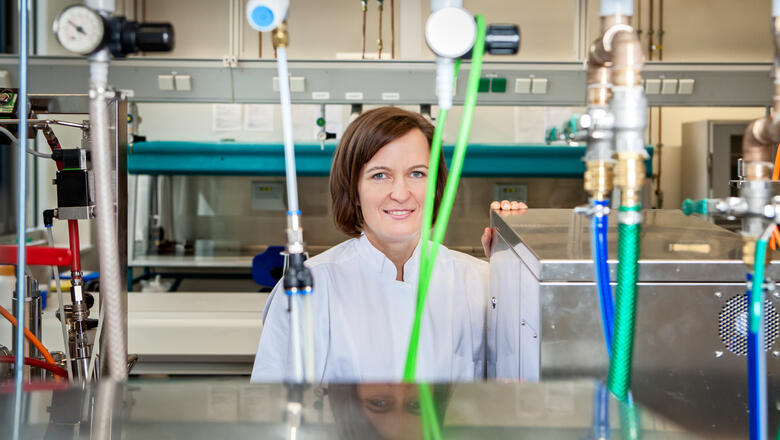Wie ist die berufliche Ausbildung zu ordnen? Diese Frage ist in diesen bewegenden Tagen aus guten Gründen etwas aus dem Blick gerückt. Ungleich „friedlicher“, ist sie aber ähnlich besetzt wie die Flüchtlingsfrage. Es geht um Inklusion und Exklusion. Zielgrößen sind im Gespräch. Es gibt klare ideologische Lager. Man verliert sich oft in Rede und Gegenrede. Verliert wichtige Zeit. Das Ausbildungssystem entwickelt sich derweil weiter, bahnt sich seinen eigenen, ungeplanten Weg.
Wie ein gutes Ausbildungssystem aussehen sollte

1. Das deutsche Bildungsschisma
Deutschland ist nach wie vor geprägt von der Dualität beruflicher und akademischer Bildung. Die berufliche Ausbildung ist sehr spezifisch, über die beruflichen Wissensbestände hinaus fehlen Breite und theoretische Bestandteile. Die akademische Bildung hingegen ist vergleichsweise breit gefächert, aber ihr fehlen die berufsbildenden Komponenten. Natürlich gibt es Ausnahmen. Recht und Medizin sind die Paradebeispiele. Beide Disziplinen nähern sich immer mehr dem an, was ich auch unter einer guten dualen Ausbildung verstehe. Mein Sohn studiert Medizin an der Charité und ist jetzt im fünften Semester. Neben den vielen verpflichtenden Pflegepraktika und Famulaturen hat er jede Menge berufsnahe Studieninhalte – und das seit dem ersten Semester.
Die Versäulung von beruflicher und akademischer Bildung ist hoch, die Durchlässigkeit gering. Es ist ein Entweder-oder. Zwar haben Meister im Handwerk und Inhaber vergleichbarer Qualifikationen seit der Entscheidung der Kultusminister­konferenz im Jahre 2009 die allgemeine Hochschul­zugangs­berechtigung erhalten. Die Anteile der Studienanfänger, die über diesen dritten Bildungsweg kommen, sind mit gerade 2,6 Prozent dennoch weiterhin sehr niedrig.
Diese Trennung der Welten ist umso erstaunlicher, als viele Barrieren im Laufe der Jahre gefallen sind. So hat sich die Bildungs- und Ausbildungsdauer beider Bereiche durch das achtjährige Gymnasium und das dreijährige Bachelorstudium angeglichen. Einige Berufe, die vormals dual ausgebildet wurden, wanderten in den Hochschulsektor oder werden nun parallel dual und in Hochschulen angeboten. Auch sind wenige duale Hochschulen entstanden, die jedoch insbesondere sehr gute Abiturienten ausbilden. Selbst die Statistik hat Grenzen aufgehoben: Meister werden nun ebenso wie Absolvierende dualer Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten zum tertiären Sektor gerechnet.
Reputation? Wie das? Werden die beiden Systeme doch von allen Verantwortlichen, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, von der Kultusministerkonferenz und sonstigen Akteuren als „gleichwertig“ bezeichnet. Ich stimme aber meinen Studierenden zu: Sie sind es nicht. Zwar unterscheiden sich die Arbeitsmarktchancen beider Gruppen kaum und liegen wesentlich höher als bei jungen Menschen ohne Ausbildung. Nimmt man die Bezeichnung aber wörtlich und bezieht sie auf den Gegenwert der Arbeitskraft, nämlich das Einkommen, kann von „gleichwertig“ keine Rede mehr sein. In Deutschland verdienen akademisch Qualifizierte im Durchschnitt 70 Prozent mehr als beruflich Ausgebildete. Bezogen auf das Lebenseinkommen bedeutet das: Hochschulabsolventen verdienen mit durchschnittlich 2,3 Millionen Euro eine Million mehr als Menschen mit einer Berufsausbildung. In diesem Zusammenhang finde ich es auch wenig hilfreich, auf den Taxi fahrenden Geisteswissenschaftler zu verweisen, da die Verdienstspanne von dual Ausgebildeten ebenso groß ist wie die akademisch Ausgebildeter.
Besonders ärgerlich ist, wenn die Gleichwertigkeit hochgehalten wird, die „Dualen“ aber als unfähig abgestempelt werden. So liest man immer wieder, die Abbruchquoten seien so hoch, weil so viele an die Hochschulen strömen, die nur für eine duale Ausbildung geeignet sind. Die Didaktik der Lehrenden oder die Bedingungen an unseren Hochschulen werden nicht infrage gestellt. Noch mal: Wir wissen nicht, wer abbricht. Und erst recht nicht, ob das gerade jene sind, die für eine duale Ausbildung gut geeignet wären. Die duale Ausbildung braucht eine höhere gesellschaftliche Reputation. Und sie verdient sie auch, weil auch hier die Besten gebraucht werden. Gegenwärtig erreicht man diese aber gerade nicht. Neben der mangelnden Reputation geht es um die begrenzten mittel- und langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten. Und hier ist ebenfalls noch viel zu tun. Der eine Weg, der Übergang von der dualen in die akademische Ausbildung, ist prinzipiell möglich, wird aber immer seltener begangen. Das hat viel mit der fehlenden, zumindest aber unsicheren Anrechnung des bereits Gelernten zu tun. Der zweite und mindestens ebenso wichtige Aspekt betrifft die Weiterbildung. Hier ist das duale System noch nicht offen und zu wenig anschlussfähig. Doch damit steht es nicht allein.
3. Was kann man tun?
Ich will an dieser Stelle den riskanten Versuch unternehmen, Kriterien für ein gutes Ausbildungssystem zu definieren. Dabei gehe ich von zwei Prämissen aus. Den Menschen steht, erstens, das im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf freie Berufswahl zu. Zweitens wird der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten eines Jahrgangs institutionell und administrativ nicht zurückgefahren.
Beide Prämissen sind voraussetzungsvoll. Sie bedeuten, dass man sich von der Vorstellung verabschiedet, man könne das Bildungs- und Berufsbildungssystem nach den Erfordernissen des Beschäftigungssystems lenken. Das hat noch nie funktioniert, allein weil sich die Bedarfe des Arbeitsmarkts laufend ändern und sogenannte Schweinezyklen entstehen. Informations- und Werbekampagnen, so etwa die MINT-Offensive (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), wirken dagegen schon eher. Der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten steht für einen zweiten analytisch wichtigen Punkt: Wer entscheidet oder, um mit Joseph Schumpeter zu sprechen, wer bremst?
In meiner Schulzeit war das die Schule. Entscheidungen wurden dabei nicht nur am Übergang zwischen Grundschule und weiterführender Schule getroffen, sondern Jahr für Jahr. In der Sexta waren wir 31 Schüler, in der Oberprima dann zwölf. Bei einer solchen rigiden Selektion, über den gesamten Jahrgang gesehen, funktionierten die traditionellen Scharniere der Berufsausbildung und der Berufswahl sehr gut. Für jede Schulstufe gab es entsprechende Ausbildungsangebote. Die Ausbildungssysteme übernahmen und selektierten selbst wenig, mit Ausnahme des Numerus clausus. Arbeitgeber konnten sich entsprechend auf die jeweiligen Übergaben verlassen. Assessment-Center waren weitgehend unbekannt. Personen und Positionen stimmten überwiegend überein und waren auf den Status bezogen.

Bei Abiturientenquoten um die 40 Prozent und höher ist das ganz anders. Selektiert wird im Ausbildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt. Und von den jungen Menschen selbst haben viel mehr als damals überhaupt eine Wahl. Die Schule hat Kompetenzen abgegeben und die Zuweisung von Menschen zu Positionen folgt anderen Prinzipien. Ich bedauere das nicht und verstehe es als Chance – auch wenn dann der Übergang zwischen Zertifizierung und erster fester Stelle länger dauert. Die Generation Praktikum ist ein Ergebnis dieses neuen Findungsprozesses. Dabei ist mir klar, dass Deutschland institutionell auf diese neue, lose Verbindung von Bildungs- und Beschäftigungssystem nicht eingestellt ist.
Dies zeigt ein kleines Beispiel. Als ich das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung leitete, durfte ich niemanden als Sekretärin oder Sekretär einstellen, wenn diese Person über einen Hochschulabschluss verfügte. Der Personalrat bestand auf einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung. Es spielte dabei keine Rolle, ob die Bewerber überhaupt einen entsprechenden Arbeitsplatz finden konnten – bei langen, oft familienbezogenen Unterbrechungen war das nicht der Fall – oder ob die Menschen mit ihrem Studium überhaupt den Wunsch nach einem entsprechenden Arbeitsplatz verbanden. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) agiert der Betriebsrat anders. In den Sekretariaten sitzen entsprechend meist diplomierte, mittlerweile ab und an auch promovierte Personen. Das Ausmaß „unterwertiger“ Beschäftigung, wie es in der Arbeitsmarktforschung heißt, ist hoch. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen.
Was sind nun die Kennzeichen eines guten Ausbildungssystems?
An erster Stelle steht für mich eine weitgehende Offenheit im Zugang. Frühe, schon von der Schule getroffene Festlegungen sind mit zu vielen Fehlern behaftet, die später nicht mehr beheben sind. Ohne eine Bildungsreform und national einheitliche Bildungsstandards ist das nicht zu erreichen.
Hinzu kommt das Gebot weitgehender Transparenz dessen, was in der Ausbildung zu erwarten ist. Hierzu braucht es mehr als Besuche der Arbeitsagenturen, Jobcenter oder Arbeitgeber in den Schulen und auch mehr als glänzende Broschüren. Ein Orientierungsjahr täte in allen Bereichen gut, vergleichbar mit dem alten Studium generale. Ich bin davon überzeugt, dass dies die Zahl abbrechender Lehrlinge oder Studierender maßgeblich verringern würde.
Wir müssen uns auch von dem Schisma der deutschen Ausbildung verabschieden. Die berufliche Ausbildung bedarf der Unterstützung durch Berufsschulen, deren Ausbildungsinhalte breiter und theoretischer als heute angelegt sein müssen. Eine Reform dieser Schulen steht dringend an. Die grundsätzliche Offenheit von Universitäten, auch berufsbezogene Elemente in ihre Ausbildung zu integrieren, erachte ich für gut, allerdings unter Wahrung des Gebots der Einheit von Forschung und Lehre. In diesem Zusammenhang muss in der Diskussion um die neue Exzellenzinitiative der Frage nachgegangen werden, wie sich Universitäten und Fachhochschulen zueinander verhalten.
„Die berufliche Ausbildung bedarf der Unterstützung durch Berufsschulen, deren Ausbildungsinhalte breiter und theoretischer als heute angelegt sein müssen. Eine Reform dieser Schulen steht dringend an.“

Die Ausbildung muss so angelegt sein, dass sie mit der traditionellen Standardisierung der Ausbildungsinhalte nicht gänzlich bricht. Die Standardisierung ermöglicht die horizontale, aber auch die vertikale Mobilität der späteren Arbeitnehmer und erlaubt zudem die nötige Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung in beide Richtungen. Diese Offenheit ist ein wesentliches Gebot, wenn wir über eine Gleichwertigkeit sprechen.
Gute Ausbildungssysteme müssen anschlussfähig über den Lebensverlauf in einem sich ändernden Arbeitsmarkt sein. Wenn wir die heutige Diskussion um die Auswirkung der Digitalisierung auf den Fachkräftemangel und Fachkräfteüberschuss verfolgen, wissen wir, dass wir eigentlich nichts wissen. Die Berechnungen und Prognosen liegen viel zu weit auseinander. Wir brauchen daher vernetzbare Systeme, an die man anschließen, die man aber im Lebensverlauf auch ganz neu ansteuern kann. Anpassungsfortbildung und Entwicklungsfortbildung sind hier die Schlagworte. Für die Personalentwicklung in Unternehmen bedeutet dies eine neue Herausforderung. So habe ich das letzte halbe Jahr darauf verwendet, für das WZB ein Personalentwicklungskonzept zu entwerfen, welches den wissenschaftsunterstützenden Bereich systematisch mit dem wissenschaftlichen Bereich verbindet und diese Wechsel im Lebensverlauf zulässt.
Einige der notwendigen Anpassungen müssen wir nicht neu erfinden. Wir können von Entwicklungen in anderen Ländern lernen, insbesondere von jenen, die mit uns die Tradition der dualen Ausbildung teilen. In Österreich und in der Schweiz bestehen heute hybride Organisationsformen, die berufliche und akademische Bildung sowie Sekundär- und Hochschulbildung systematisch verbinden.
„Hybridität bedeutet hier eine Form der institutionellen Durchlässigkeit, da inhaltliche und regulative Elemente aus den Bereichen Bildung und Hochschule als gleichwertig angesehen und miteinander verzahnt werden.“ (Graf, Lucas, 2013: Besser verzahnt. Berufs- und Hochschulbildung in Österreich und der Schweiz. WZBrief Bildung 24. Berlin 2013, Seite 2.) Der Schweizer Weg führt von der dualen Lehre über eine Berufsmaturität an eine Fachhochschule. In Österreich haben sich die berufsbildenden höheren Schulen entwickelt, die eine gezielte Mischung aus klassischer Berufs- und Hochschulbildung anbieten. Beide Wege beginnen in der Sekundarstufe und bauen von dort eine direkte Brücke zu den Hochschulen.
Will man solche Wege auch in Deutschland gehen, so müssen wir über die staatliche und private Finanzierung von Bildung und Ausbildung sprechen und darüber, in welche Bereiche die Gelder hauptsächlich fließen. Und wir brauchen die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, also von Bund, Ländern, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Bildungsbürgertum und Hochschulen.