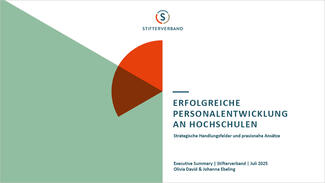Erfolgreiche Personalentwicklung an Hochschulen
Strategische Handlungsfelder und praxisnahe Ansätze
für Hochschulen im Wandel


Hochschulen stehen – auch in der Personalentwicklung – unter Druck: Ein sich verstärkender Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, knapper werdende finanzielle Mittel, Besonderheiten des Befristungsrechts und sich verändernde Kompetenzbedarfe sind nur einige der wesentlichen Herausforderungen. Personalentwicklung und Personalstrukturplanung erfolgreich umzusetzen, gewinnt somit an Bedeutung und erfordert hochschulintern entsprechende Aufmerksamkeit.
Langfristige Personalentwicklungsziele zu verfolgen, ist dabei alles andere als leicht. Häufig rutschen sie vor dem Hintergrund kurzfristiger Prioritätensetzung, begrenzter Ressourcen und der Vielzahl an Akteurinnen und Akteure, deren Interessen berücksichtigt werden müssen, in der Prioritätenliste nach unten. In diesem Spannungsfeld stellt sich die Frage: Wie kann Personalentwicklung gezielt so gestaltet werden, dass sie nicht nur reagiert, sondern proaktiv zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Hochschulen und ihres wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützende Personals beiträgt?
Vor diesem Hintergrund setzt sich das im Juli 2025 veröffentlichte Paper mit den Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Personalentwicklung auseinander und bietet anhand von ausgewählten Themenfeldern einen strategischen Blick auf Personalentwicklung an Hochschulen. Auch wenn es in der Personalentwicklung an Hochschulen insbesondere aufgrund der sehr unterschiedlichen strukturellen Verankerung kein "One size fits all" geben kann, so lassen sich dennoch Aspekte identifizieren, die über den Einzelfall hinaus Wirkung entfalten. Diese werden anhand von sieben strategischen Themenfeldern skizziert. Ihnen vorangestellt ist ein kurzer Exkurs zur Rolle der Hochschulleitung für erfolgreiche Personalentwicklung, da sie übergreifend für Themenfelder besondere Relevanz besitzt.
Das Paper entstand aus einer Initiative des Stifterverbandes heraus in einem mehrschrittigen, co‐kreativen Prozess gemeinsam mit Personalentwicklungsexpertinnen und ‐experten von Hochschulen und wissenschaftsnahen Einrichtungen.
Sieben strategische Handlungsfelder der Personalentwicklung
Personalentwicklung trägt zur Stärkung einer dialog‐ und lernorientierten Hochschulkultur bei. Durch Formate, die neue Rollenbilder, Kommunikationsstile und Arbeitsweisen sichtbar und erfahrbar machen – wie etwa ein gemeinsames Onboarding für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wissenschaft und Verwaltung – leistet sie einen Beitrag zur Weiterentwicklung des institutionellen Selbstverständnisses. Ihre Wirkung steigt, wenn Personalentwicklung eng mit Querschnittsthemen wie Diversität, Internationalisierung oder der Resilienz der Organisation verzahnt ist.
Die Aufgaben der Personalentwicklung liegen an vielen Hochschulen sowohl in zentralen Einheiten als auch auf Ebene der Fakultäten oder Einrichtungen. Eine produktive Zusammenarbeit erfordert klare Rollen, abgestimmte Prozesse und eine vertrauensvolle Kommunikationskultur. Regelmäßige Austauschformate – etwa ein Runder Tisch Personalentwicklung – sowie fakultätsinterne Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können helfen, Abstimmungswege zu verkürzen, Synergien zu heben und Doppelstrukturen zu vermeiden.
Oft sind die Angebote und Zuständigkeiten für wissenschaftliches Personal und für Mitarbeitende in Technik, Verwaltung und Infrastruktur getrennt organisiert. Um Ressourcen wirksamer zu nutzen, braucht es ein gemeinsames Verständnis, abgestimmte Standards und eine transparente, gut zugängliche Angebotsstruktur – etwa über ein zentrales Weiterbildungsportal. Nur so gelingt eine kohärente Personalentwicklung für alle Beschäftigtengruppen.
Personalentwicklung entfaltet dann nachhaltige Wirkung, wenn sie langfristig ausgerichtet ist und nicht mit einzelnen Personen oder Projekten steht und fällt. Eine formale Verankerung in Hochschulentwicklungsplänen, Qualitätssicherungsinstrumenten oder Berufungsverfahren kann helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ebenso wichtig sind tragfähige Netzwerke engagierter Personen in der Personalentwicklung,
Um Fortschritte sichtbar zu machen und Entwicklung gezielt zu steuern, ist eine regelmäßige Reflexion über Reichweite, Wirkung und Qualität von Personalentwicklungsmaßnahmen sinnvoll. Evaluationen sollten sich an klaren strategischen Fragestellungen orientieren – etwa: Welche Kompetenzen wurden aufgebaut? Welche Angebote entfalten nachhaltige Wirkung? Die Bereitschaft, auf dieser Grundlage auch Entscheidungen über das Ende oder die Weiterentwicklung einzelner Maßnahmen zu treffen, ist Teil einer lernenden Organisation.
Hochschulen stehen vor komplexen Herausforderungen, die nicht allein durch gute Fachkenntnisse, sondern durch wirksame Führung bewältigt werden. Dazu gehören ein reflektierter Umgang mit Verantwortung, ein konstruktives Arbeitsumfeld, die Gestaltung von Veränderungsprozessen und ein aufmerksames Miteinander im Alltag. Ein gemeinsam erarbeitetes Führungsverständnis, passgenaue Angebote für neue Professorinnen und Professoren sowie gemeinsame Lernformate für Führungskräfte aus Wissenschaft und Verwaltung tragen dazu bei, Führungskompetenz systematisch zu fördern und Perspektivwechsel zu ermöglichen.
Die Bedingungen in der wissenschaftlichen Qualifikationsphase sind geprägt durch Unsicherheit und Befristung. Personalentwicklung kann hier Orientierung geben, indem sie frühzeitig unterschiedliche Karrierewege sichtbar macht – innerhalb der Wissenschaft – sowie intersektorale Mobilität aktiv unterstützt. Strukturierte Weiterbildungsprogramme, Mentoringformate und individuelle Beratung, flankiert von guter interner wie externer Vernetzung, erhöhen Planbarkeit und stärken die Bindung von Beschäftigten an die Hochschule.
Empfehlungen
- Strategisch verankern: Personalentwicklung sollte fester Bestandteil von Hochschulentwicklung, Qualitätsmanagement und Berufungsverfahren sein – nicht zuletzt, um ihre Relevanz gegenüber anderen Steuerungszielen sichtbar zu machen.
- Ressourcen priorisieren: Ausreichende Mittel für Programme, qualifiziertes Personal und Weiterentwicklungsprozesse sind notwendig, um Personalentwicklung verlässlich und wirksam zu gestalten.
- Datenbasiert steuern: Monitoring und Erheben von Daten sowohl für die interne Steuerung als auch für die Rechenschaft gegenüber Gremien und Öffentlichkeit.
- Kultur leben: Die Hochschulleitung hat eine zentrale Vorbildfunktion. Ihre Haltung zu Lernen, Zusammenarbeit und Entwicklung prägt den Möglichkeitsraum für Personalentwicklung in der Organisation.
- Dialog fördern: Gute Personalentwicklung braucht Austausch. Es empfiehlt sich, regelmäßige institutionalisierte Formate zu schaffen, in denen Leitung, Verwaltung und Wissenschaft ihre Perspektiven einbringen und gemeinsame Vorhaben gestalten können.
Fazit
Strategische Personalentwicklung ist kein Zusatzangebot, sondern eine zentrale Voraussetzung für zukunftsfähige Hochschulen. Sie trägt dazu bei, institutionelle Veränderung zu gestalten, Kompetenzen zu sichern und Beschäftigte in ihrer Vielfalt zu stärken. Wer Personalentwicklung als Querschnittsaufgabe begreift und strukturell wie kulturell verankert, schafft die Grundlage dafür, dass Hochschulen nicht nur Orte exzellenter Forschung und Lehre bleiben, sondern auch attraktive Arbeits‐ und Lernorte für die Menschen, die sie tragen.

Stifterverband Change unterstützt Hochschulen mit verschiedenen Angeboten zur Strategieentwicklung im Bereich Personalentwicklung, unter anderem mit einem Audit – einem Entwicklungsinstrument, um sich hier bestmöglich aufzustellen.
Strategieentwicklung im Bereich Personalentwicklung
Audit Personalentwicklung