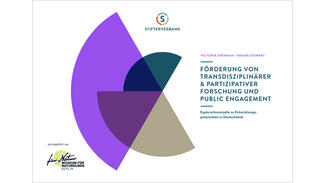Förderung von transdisziplinärer & partizipativer Forschung und Public Engagement
Explorationsstudie zu Entwicklungspotenzialen in Deutschland

Die großen Herausforderungen der Gegenwart – von der Klimakrise über Digitalisierung bis zu gesellschaftlicher Polarisierung – lassen sich nicht aus isolierten Perspektiven lösen. Forschung steht zunehmend in der Verantwortung, Wissen nicht nur zu erzeugen, sondern aktiv zur Bewältigung gesellschaftlicher Transformationen beizutragen.
Die im November 2025 vom Stifterverband veröffentlichte Explorationsstudie zeigt, wie transdisziplinäre und partizipative Forschung sowie Public Engagement mit Forschung dazu beitragen können, Wissenschaft und Gesellschaft enger zu verzahnen – und welche strukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.
In den vergangenen Jahren hat sich der wissenschafts- und forschungspolitische Diskurs in Teilen spürbar verändert: weg von einer Forschung für die Gesellschaft hin zu einer Forschung mit der Gesellschaft. Zahlreiche nationale und internationale Strategien – von der UNESCO über die Europäische Kommission bis zum Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt – betonen die Bedeutung von Teilhabe, Offenheit und gesellschaftlicher Relevanz wissenschaftlichen Arbeitens.
Vor diesem Hintergrund hat das Museum für Naturkunde Berlin mit der Berlin School of Public Engagement and Open Science eine explorative Studie für den Stifterverband durchgeführt. Sie untersucht, wie die oben genannten Prinzipien in der deutschen Forschungslandschaft umgesetzt werden, wo Förderstrukturen und Anreizsysteme greifen – und wo bislang Lücken bestehen.
Ziel der Studie
Die Studie beleuchtet, wie transdisziplinäre und partizipative Forschung sowie Public Engagement (TPPE) in Deutschland systematisch gefördert, institutionell verankert und kulturell gestärkt werden können. Anhand einer Analyse von Strategien, Akteurinnen und Akteuren, Organisationsmodellen und Fallbeispielen zeigt sie,
- wie politische und institutionelle Rahmenbedingungen für Forschung mit der Gesellschaft gestaltet werden können,
- welche Strukturen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine langfristige Integration ermöglichen
- und wie Forschende unterstützt werden können, gesellschaftliche Relevanz als festen Bestandteil wissenschaftlicher Qualität zu begreifen und zu integrieren.
Damit trägt die Studie zu einer Standortbestimmung bei: Sie zeigt, was in Deutschland bereits gut funktioniert, was noch unzureichend entwickelt ist – und wo die größten Potenziale für eine Wissenschaft liegen, die gesellschaftlich wirksam und demokratisch verankert ist.
Zentrale Ergebnisse
Die Studie kombiniert empirische Analysen, vertiefende Fallbeispiele und strategische Empfehlungen – und zeichnet so ein umfassendes Bild der Förderung von transdisziplinärer und partizipativer Forschung sowie Public Engagement in Deutschland.
Aktuelle Praxis und Rahmenbedingungen
Eine bundesweite Onlineumfrage sowie Einzelinterviews mit zentralen Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Förderinstitutionen zeigen:
- In Deutschland gibt es eine hohe Bereitschaft und wachsende Expertise für partizipative und transdisziplinäre Forschung. Gleichzeitig bleiben viele Aktivitäten punktuell, oft projektgebunden und abhängig vom Engagement Einzelner.
- Häufig fehlen klare Strukturen, dauerhafte Fördermechanismen und anerkannte Bewertungsmaßstäbe. Die Untersuchung macht deutlich, dass politische Programme, Förderlinien und institutionelle Zuständigkeiten bislang fragmentiert und kurzfristig ausgerichtet sind – ein Hindernis für langfristige Wirkung und kulturelle Verankerung.
Institutionelle Modelle und Praxisbeispiele
Fünf Fallstudien veranschaulichen, wie nachhaltige Strukturen entstehen können:
- Das britische National Coordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) zeigt, wie sektorweite Koordination und Kulturwandel initiiert werden können.
- Die Technische Universität München und die Universität Tübingen verdeutlichen, wie Public Engagement und partizipative Forschung in Hochschulstrategien, Lehre und Management verankert werden.
- Fraunhofer MEVIS und der Wissenschaftsladen Bonn demonstrieren, wie außeruniversitäre Einrichtungen über Netzwerke, Kooperationen und kreative Formate nachhaltige Beteiligungsmodelle entwickeln.
Handlungsempfehlungen für Politik und Institutionen
Auf Basis dieser empirischen und praxisnahen Erkenntnisse formuliert die Studie konkrete Empfehlungen:
- Sie fordert systemisch koordinierte Förderstrukturen, die ressortübergreifend abgestimmt und auf alle Phasen des Forschungsprozesses ausgelegt sind.
- Zugleich plädiert sie für neue Bewertungs- und Anreizsysteme, die gesellschaftliche Wirkung als Qualitätsmerkmal wissenschaftlicher Arbeit anerkennen, und für den Aufbau und die Unterstützung langfristiger Infrastrukturen, Kompetenzzentren und Karrierepfade für Forschende an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft.
BIBLIOGRAPHSICHE ANGABEN
Victoria Shennan & Mhairi Stewart:
Förderung von transdisziplinärer & partizipativer
Forschung und Public Engagement
Herausgegeben vom Stifterverband
Essen 2025
Die Publikation steht unter einer
Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA 4.0).
Diese Lizenz gilt nur für die von den
Autorinnen erstellten Originalinhalte.
Kontakt

Wiebke Hoffmann
ist Teamleiterin im Fokusthema "Impact of Science stärken".
T 030 322982-323