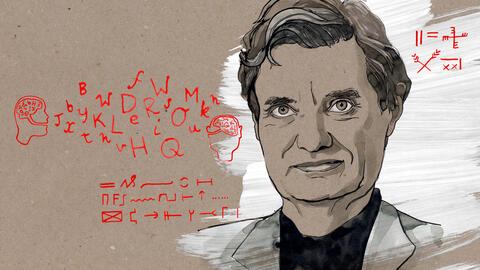Der Plural von Substantiven ist etwas sehr Einfaches: Er bezeichnet Mehrheiten – aber Mehrheiten wovon? Vielleicht von dem, was ein Substantiv im Singular bedeutet? So sieht es aus, aber so ist es nicht. Denn der Singular kann Einzahl bezeichnen, muss er aber nicht. Mit einem Satz wie Ein Lehrer ist kein fauler Sack haben wir dieselbe Bedeutung wie mit Lehrer sind keine faulen Säcke. Was der Plural kann, das kann der Singular in solchen und anderen Fällen auch, aber was der Singular kann, das kann der Plural meistens nicht. In einem Satz wie Dieser Fußballfan singt besonders schön haben wir nur die Einzahl. Offenbar hat der Plural eine speziellere Bedeutung als der Singular, dessen Bezeichnung insofern irreführend ist, als er Einzahl und Mehrzahl bezeichnen kann.
Die Sprachwissenschaft spricht etwas schwerfällig von der „markierten“ Kategorie Plural und der „unmarkierten“ Kategorie Singular. Man kann auch sagen, der Singular sei unspezifisch, bezeichne das Allgemeine oder den Hintergrund, der Plural das Bild. Das Verhältnis der beiden zueinander ist nicht symmetrisch. Das ist bei allen vergleichbaren Paaren von Kategorien so, etwa im Verhältnis Indikativ/Konjunktiv, Präsens/Präteritum, Maskulinum/Femininum und vielen anderen. Diese für das grammatische Denken grundstürzend wichtige Erkenntnis geht auf den russisch-amerikanischen Sprachwissenschaftler Roman Jakobson zurück. Er entwickelte sie in den 1930er-Jahren am Kasussystem des Russischen. Bei Weitem nicht alle Sprachen haben überhaupt einen Plural, was ja nach dem über den Singular Gesagten ganz verständlich ist.
In der Mehrheit
, via [pexels.com](https://www.pexels.com/photo/bind-blank-blank-page-business-315790/)_bearbeitet Foto: [CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de), via [pexels.com](https://www.pexels.com/photo/bind-blank-blank-page-business-315790/)_bearbeitet](/sites/default/files/styles/1080x607/public/bind-blank-blank-page-315790_pexels_cc0_16_9_schrift.jpg?itok=CDPtQAyN)
„Man sucht Plurale häufig dort, wo man eine sogenannte geschlechtergerechte Sprachverwendung fordert. “

Das Deutsche hat für alle möglichen Wörter einen Plural, für Pronomina ebenso wie für Adjektive, für Substantive ebenso wie für Verben. Es gibt aber auch im Deutschen Wörter, die nur einen Singular und keinen Plural haben (zum Beispiel Obst, Schmuck, Wild, Ruhe, Hunger; siehe auch die Kolumne Bürokratische Plurale vom November 2017). Andere haben dagegen nur den Plural. Auch diese sogenannten Pluraliatantum wie Ferien, Eltern, Möbel, Leute, Spesen sind nicht sehr häufig. Sie fallen auch dadurch auf, dass sie kein grammatisches Geschlecht (Genus) haben.
Die Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum sind im Deutschen auf den Singular beschränkt. Die Form der Lehrer ist maskulin, der Plural die Lehrer aber nicht. Er ist genuslos, was der Verwendung des Plurals in letzter Zeit Auftrieb gegeben hat. Man sucht Plurale häufig dort, wo man eine sogenannte geschlechtergerechte Sprachverwendung fordert. So haben wir den Unterschied von Singular und Plural in Paaren wie der Student – die Studentin mit den Pluralen die Studenten – die Studentinnen, aber in die Studierenden gibt es keinen Hinweis auf einen maskulinen oder femininen Singular. Auch Formen mit dem Genderstern wie die Lehrer*innen stehen meist im Plural. Welche Singularformen sie haben, ist umstritten. Möglicherweise vermehren sie den Bestand an Pluraliatantum erheblich.
Der chaotische Plural
Wie sieht nun der Plural beim Substantiv aus? Die Pluralbildung des deutschen Substantivs gilt seit jeher als unübersichtlich, ja als chaotisch. Unsere Grammatiken unterscheiden zwischen fünf und mehr als 20 Pluraltypen, man streitet sich trefflich. In seinem bekannten Buch „Wörter und Regeln. Die Natur der Sprache“ (Heidelberg 2000) erlaubt sich der prominente amerikanische Sprachwissenschaftler Steven Pinker die Frage: „Kann es eine Sprache geben, die so pervers, so verdreht, so sadistisch ist, dass sie ihren Sprechern in der Mehrheit der Fälle irreguläre Formen aufzwingt?“ Die Pluralbildung sei so komplex, um „die Sprachlerner auf Zack zu halten“. Gemeint ist das Deutsche.
Man darf solche Äußerungen getrost als unseriös ansehen. Sie sind der amerikanischen Grusel- und Verkaufskultur geschuldet. Trotzdem sollten wir über eine Strategie verfügen, mit der Wichtiges von Unwichtigerem und Systematisches von Einzelfällen unterschieden werden kann, etwa die folgende:
- Finde zunächst heraus, welche Plurale im Gegenwartsdeutschen produktiv sind, das heißt welche auf neu gebildete oder entlehnte Wörter übertragen werden, und kümmere dich erst danach um die Typen, die vielleicht zahlreich vertreten, aber nicht produktiv sind.
- Finde heraus, welche der Typen tatsächlich morphologisch unterschieden sind und welche nur lautlich in dem Sinn, dass die Form des Stammes entscheidet, wie eine Pluralform aussieht.
Der besondere Plural des Neutrums wird mit -er gebildet (Kind – Kinder, Buch – Bücher). Er hat Umlaut, wenn Umlaut möglich ist, der besondere des Femininums hat immer Umlaut.
Die Regeln sind in einigen Einzelheiten etwas grob formuliert und sollten in einer Grammatik nachvollzogen und anhand vieler Beispiele durchdrungen werden. Als Daumenregeln und zur Bildung einer Vorstellung vom Pluralsystem des deutschen Kernwortschatzes sind sie aber bestens geeignet, zumal man auch erklären kann, warum gerade die genannten und nicht andere Endungen für den Plural verwendet werden. Kinder haben im normal verlaufenden Spracherwerb keinerlei Mühe, dieses einfache System zu erwerben. Das sollte sich auch Steven Pinker vor Augen führen.
, via [pixabay.com](https://pixabay.com/de/licht-gl%C3%BChbirnen-hoffnung-gl%C3%BChen-2156209/) Foto: [CC0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de), via [pixabay.com](https://pixabay.com/de/licht-gl%C3%BChbirnen-hoffnung-gl%C3%BChen-2156209/)](/sites/default/files/styles/780x440/public/intelligenz_gluehbirnen_light-2156209_1920_cc0_colin00b_pixabay_16_9.jpg?itok=bBawVZ5I)