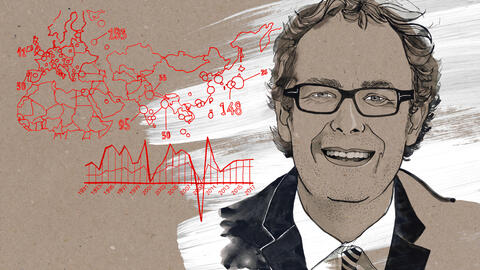Spätestens seit der Finanzkrise ist eine intensive Diskussion in Wissenschaft und Öffentlichkeit über die Ökonomie als Wissenschaft entbrannt. Auch auf der vom Stifterverband initiierten Tagung „Ökonomie neu denken“ geht es regelmäßig darum, wohin die Ökonomie als Wissenschaft steuert. In manchen Medien wird der Ökonomie zudem – aus meiner Sicht zu Unrecht – ein mangelnder Pluralismus vorgeworfen.
Dabei sind die heute von Ökonomen benutzten Methoden, spätestens seit dem Aufkommen von experimenteller Wirtschaftsforschung, Verhaltensökonomik und Neuroökonomie, vielfältiger denn je. Auch thematisch befassen sich Ökonomen längst nicht mehr nur mit streng ökonomischen Fragen, etwa welche Faktoren Inflation, Konjunktur, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Finanzkrisen, Kartellbildung, Innovationen, Kaufentscheidungen oder andere Wirtschaftsphänomene beeinflussen und verursachen. Vielmehr scheint heute alles zum Bereich der Ökonomie zu gehören, womit sich Ökonomen beschäftigen. „Economics is what economists do“ – so hatte es der kanadische Ökonom Jacob Viner schon vor mehr als 80 Jahren ausgedrückt.
Die Ökonomie als Wissenschaft: publish or perish, Peer Review, Mathturbation und Freakonomics

Was Sumoringen mit Ökonomie zu tun hat
Einer der Pioniere der Analyse von Randthemen mit interessanten Datensätzen ist Steven Levitt, der seine Befunde gekonnt in dem sehr unterhaltsamen Bestseller „Freakonomics“ (http://freakonomics.com/) zusammengefasst hat. In der Tat finden sich in jüngerer Zeit in der „American Economic Review“, der weltweit führenden Fachzeitschrift für Ökonomie, Beiträge zu Fragen wie etwa,
- ob es im Sumoringen in Japan Anzeichen für Absprachen gibt (überraschende Antwort: Ja),
- wie sich Leute bei Spielshows im Fernsehen verhalten,
- wie Fußballspieler am besten einen Elfmeter schießen sollten,
- ob die Ausstrahlung der Fernsehserie „16 and Pregnant“ auf dem Sender MTV die Anzahl der Schwangerschaften bei Teenagern reduziert (Antwort: Ja) oder
- ob Menschen, deren Mütter während der Schwangerschaft einen nahen Verwandten verloren haben (etwa den Kindesvater), in ihrem späteren Leben häufiger unter psychischen Erkrankungen leiden als andere (Antwort: Ja).
„More young economists today are doing Levitt-style economics and fewer are studying the classic questions of economic policy.“
Treiber all dieser Aufsätze ist nicht etwa, dass die Frage aus ökonomischer Perspektive besonders relevant wäre. Vielmehr gibt es in diesen Bereichen besonders gute Daten, die eine methodisch raffinierte und umfassende empirische Analyse ermöglichen. Dies erinnert an den alten Witz von dem Betrunkenen, der seine verlorenen Schlüssel unter der Laterne sucht, weil es dort besonders viel Licht gibt, eigentlich aber weiß, dass der Schlüssel (zur Erkenntnis) ganz woanders (im Dunkeln) liegt.
Die intensive Befassung mit Randthemen hat der prominente Ökonom N. Gregory Mankiw, Verfasser des weltweit wohl bekanntesten und erfolgreichsten Ökonomielehrbuchs, schon 2007 wie folgt kritisiert: „[M]ore young economists today are doing Levitt-style economics and fewer are studying the classic questions of economic policy. That is disconcerting, to a degree. It could be especially problematic twenty years from now, when President Chelsea Clinton looks for an economist to appoint to head the Federal Reserve, and the only thing she can find in the American Economic Association are experts on game shows and sumo wrestling.“
Die Kritik an der Beschäftigung mit randseitigen Themen wird nun durch einen Skandal um den oben zuletzt genannten Aufsatz befeuert. Zum Hintergrund: Eine Publikation in der „American Economic Review“ ist oftmals karriereentscheidend für viele Ökonomen. In den USA hängen Tenure-Entscheidungen daran, in Deutschland garantiert eine solche Publikation im Grunde den Ruf auf einen Lehrstuhl. Eine Publikation in der „American Economic Review“ ist der ultimative Ritterschlag für akademische Ökonomen.
In dem besagten Beitrag beschäftigen sich zwei junge Wissenschaftlerinnen mit der Frage, ob sich pränataler Stress für einen Ungeborenen anders auf die Wahrscheinlichkeit späterer psychischer Probleme auswirkt als postnataler Stress für einen Säugling. Der Beitrag durchlief – trotz seines fehlenden Bezugs zu ökonomischen Themen – den typischen anonymen Begutachtungsprozess und wurde nach einigen Überarbeitungen zur Publikation angenommen. In einem anonymen Internetforum namens „Economic Job Market Rumors", über das auch das Handelsblatt in der Vergangenheit schon berichtet hat, wurde sodann enthüllt, dass der Beitrag kaum etwas Neues enthält. Die mit der fast identischen Methode und den nahezu identischen Daten durchgeführten Untersuchungen gibt es bereits. Nur wurden diese Beiträge sinnvollerweise in medizinischen Fachzeitschriften publiziert und von den beiden Autorinnen – womöglich strategisch – nicht zitiert.
„Weil Daten zu wichtigen wirtschaftlichen Themen oftmals fehlen oder nicht verfügbar sind, beschäftigen sich viele Ökonomen zunehmend mit aus ökonomischer Sicht randseitigen Themen.“
Was sich seitdem entfaltet hat, ist eine Schlammschlacht. Die Autorinnen beantworteten die Kritik vor allem damit, dass sie Kritikern die Sexismuskeule über den Schädel zogen, ohne auf den Inhalt der Kritik einzugehen. Gleichwohl revidierten sie ihren noch im Erscheinen begriffenen Beitrag nach der Annahme noch mehrere Male erheblich, ohne dass eine weitere Begutachtung stattfand. Pikant ist das Ganze auch, weil die verantwortliche Herausgeberin entgegen den Standards der American Economic Association nicht offenbart hat, dass sie als Co-Autorin einer der beiden jungen Autorinnen einen potenziellen Interessenkonflikt hat. Das Ganze wurde jüngst prägnant von George Borjas, einem sehr prominenten Harvard-Ökonomen, in seinem Blog (https://gborjas.org/2016/06/30/a-rant-on-peer-review/) zusammengefasst. Die Herausgeber der „American Economic Review“ schweigen bisher beharrlich zu dem Vorgang.
Die offensichtlichen Probleme mit den mangelhaften Standards guter wissenschaftlicher Praxis bei der für uns Ökonomen wichtigsten Fachzeitschrift geben Anlass zu erheblicher Besorgnis. Gleichwohl deuten sie auf ein tieferes Problem hin: Weil Daten zu wichtigen wirtschaftlichen Themen oftmals fehlen oder nicht verfügbar sind, beschäftigen sich viele Ökonomen zunehmend mit aus ökonomischer Sicht randseitigen Themen, bei denen weder Autoren noch Gutachter die dazu vorhandene Literatur zu kennen scheinen. Der Beitrag über die MTV-Sendung und Schwangerschaften von Teenagern litt bereits unter demselben Manko. Innovation ist in diesen Fällen oft ein Mangel an Belesenheit. Dass dies zu wissenschaftlichem Fortschritt beiträgt, ist unwahrscheinlich, denn auch Mediziner werden kaum in Ökonomiefachzeitschriften nach neuem Erkenntnisgewinn über die Auswirkungen pränatalen Stresses suchen. Wir Ökonomen täten daher gut daran, uns wieder stärker auf den Kern unseres Untersuchungsbereiches zu beschränken, auch wenn die Früchte dort höher hängen und wir wohl mehr im Dunkel herumstochern, wo gerade keine Laterne steht, aber vielleicht doch der Schlüssel zum Erkenntnisgewinn liegt. Auf der nächsten „Ökonomie neu denken“-Tagung wird es noch immer viel zu diskutieren geben.