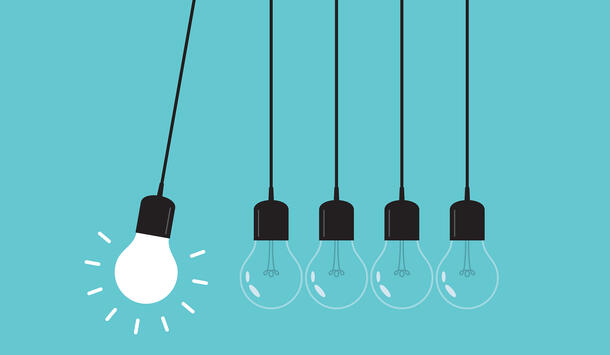Nicolas Wöhrl spielt gern MacGyver: Gleich dem Serienheld mit Sinn für überraschende Erfindungen funktioniert Wöhrl eine Batterie und ein Kaugummipapier zum Feuerzeug um. „Brennt ganz schön!“, kommentiert der promovierte Physiker in seinem Podcast „Methodisch inkorrekt“. Es folgt die bange Frage: „Wo sind hier eigentlich die Rauchmelder?“ Keine Sorge – der Versuch geht gut aus: für Wöhrl, seinen Podcasterkollegen Reinhard Remfort und für den Hörer, der en passant auch noch das Stromwärmegesetz erklärt bekommt. Auch das Experiment „Podcast“ hat für Wöhrl und Remfort einen guten Verlauf genommen: Erfolgreiche Folgen von „Methodisch inkorrekt“ werden mittlerweile 60- bis 70.000-mal heruntergeladen. Noch ist es eine Minderheit der Forscher, die die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte per Podcast – wie die Duisburger Wöhrl und Remfort – in die eigene Hand nehmen.
Wissenschaftskommunikation
Der Ton macht die Wissenschaft

Übersicht: Deutsche Wissenschaftspodcasts
Mittlerweile haben einige professionelle Wissenschaftler, aber auch Amateurforscher das Medium Podcast entdeckt, um über ihren Berufsalltag oder ihr Fachgebiet zu erzählen. Dazu zählen etwa die „Sternengeschichten“ des Astronomen Florian Freistetter, „Proton“ mit einer Einführung in die Welt der chemischen Elemente oder der Archäologie-Podcast „Angegraben“ von Mirko Gutjahr. Der österreichischen Historiker Daniel Meßner betreibt gemeinsam mit seinem Kollegen Richard Hemmer den Geschichts-Podcast „Zeitsprung“, Familienforschung hörbar macht der Genealoge Timo Kracke. Im „Psycho-Talk“ betrachten drei Diplom-Psychologen die Welt durch die Brille ihrer Disziplin.
Dazu gibt es Formate mit einem breiteren Fokus auf das Wissenschaftsgeschehen oder speziellere Phänomene. Einer der populärsten Podcasts dazu ist „Hoaxilla“, in dem die beiden „Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens“ Alexa und Alexander Waschkau moderne Sagen – sogenannten Hoaxes – aufdecken. Über aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft sprechen Holger Klein und Florian Freistetter in „Wrint“ sowie Tim Prilove mit seinen Gästen im Podcast CRE. Das „Forschungsquartett“ von detektor fm blickt jede Woche auf neue Entwicklungen und Ergebnisse in der deutschen Forschungslandschaft. Zu den Schwerpunkten im Feld der Computer- und Ingenieurswissenschaften sowie Luft- und Raumfahrt interviewen Nora Ludewig und Markus Völter Experten in „Omegatau“. Über „Open Science“ sprechen regelmäßig Matthias Fromm und Konrad Förstner im „Open Science Radio“.
Resonator heißt der von Holger Klein betreute Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft podcastet rund um Themen aus ihren Instituten. Melanie Bartos spricht in „Zeit für Wissenschaft“ mit Mitarbeitern verschiedenster Fachrichtungen an der Uni Innsbruck über das „Was?“ und „Wie?“ ihrer Forschungsarbeit. Der vom Stifterverband ausgezeichnete „Modellansatz“ ist ein Podcast des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), in dem Sebastian Ritterbusch und Gudrun Thäter darüber berichten, woran Forscher der Fakultät für Mathematik gerade tüfteln. Um „Medienforschung“ geht es im „BredowCast“ des Hamburger Hans-Bredow-Instituts. Tim Pritlove produziert für den Stifterverband „Forschergeist“ - Horizonte für Bildung und Forschung.
Jede Woche sendet der Deutschlandfunk ein Feature zu „Wissenschaft im Brennpunkt“, das anschließend als Podcast ins Netz gestellt wird. Der digitale „Schwestersender“ DRadio Wissen hat mit „Eine Stunde History“ mit den erfolgreichsten deutschen Podcast im Angebot. Der SWR bietet in seinen Podcasts unter anderem monothematische 30-Minuten-Sendungen zu verschiedenen Wissenschaftsthemen an. Der Name „IQ – Wissenschaft und Forschung“ ist Programm in diesem Podcast von Bayern 2 – mit zwei wöchentlichen Features zum Nachhören. Auch das WDR 5-Wissenschaftsmagazin „Leonardo“ ist als Podcast verfügbar, ebenso das Magazin „Logo“ vom NDR, „Wissenswert“ vom Hessischen Rundfunk, „Wissenswerte“ vom rbb, oder das Magazin der „Deutschen Welle“.
Magazine mit Wissenschaftsbezug wie „Zeit Wissen“ oder „Spektrum der Wissenschaft“ haben mittlerweile ebenfalls eigene Podcasts. Auch die bekannten englischsprachigen Zeitschriften „Science“ und „Nature“ bieten Hörstücke zum Herunterladen an.
Ein kuratiertes Angebot im Bereich der Wissenschaftspodcasts zu schaffen – das ist das Ziel der 2015 gegründeten Seite wissenschaftspodcasts.de. Ein halbes Dutzend an Podcastern hat für die Seite Beiträge aus den unterschiedlichsten Disziplinen ausgewählt. Podcasts zu Bildung und Kulturwissenschaften finden sich dort genauso wie solche zu Naturwissenschaft und Technik oder zu Medizin und Pharmazie. Wissenschaftspodcasts.de baut auf der Podcast-Sammlung auf, die Henning Krause für den Blog „Augenspiegel“ der Helmholtz-Gemeinschaft erstellt hat. Ebenfalls eine Liste mit wissenschaftliche Podcasts und Radio-on-demand-Angeboten hat sciencegarden.de im Angebot.
Vor allem zwei Faktoren sind es, mit denen Podcasts von und mit Wissenschaftlern gegenüber tagesaktuellen Radiosendungen wie „Forschung aktuell“ (Deutschlandfunk) punkten können: Zeit und Persönlichkeit. „Forscher, die das erste Mal in einem Podcastgespräch zu Gast waren, haben ganz überrascht gesagt: ‚Endlich hat mir mal jemand zugehört‘“, erzählt Henning Krause, Social-Media-Manager der Helmholtz-Gemeinschaft, die unter anderem den Podcast „Resonator“ verantwortet.
Seine Wissenschaftspodcasts, betont der Berliner Podcaster Tim Pritlove, würden vom Gesprächspartner wie vom Hörer „explizit als Vertiefungsformat angenommen“. Im Dialog könne er komplexe wissenschaftliche Sachverhalte in der Zeit, die es eben brauche, ausbreiten. „Jenseits von Wissen und Erkenntnis lassen sich im Podcast aber auch viele Metainfos – etwa zu Wissenschaftlerkarrieren – rüberbringen, die sonst kaum thematisiert werden“, sagt Krause. Lebensläufe, die sich in magischen Hörmomenten vermitteln, wie sie Pritlove unlängst erlebt hat.
Wissenschaftler werden im Podcast zum Menschen, sagt Nicolas Wöhrl, „und auf ihrem manchmal steinigen Weg zu Entdeckungen passieren die interessantesten Geschichten“. Über solche Hindernisse und Misserfolge zu erfahren, sei für Hörer nicht nur spannend; in Podcasts lasse sich, über Scheitern als Chance zum Lernen, auch das Prozesshafte von Wissenschaft darstellen – und zugleich Transparenz über die Verwendung öffentlicher Gelder herstellen.
„Wir hatten schon recht viele Schüler da, die sich von uns zum Studium inspirieren lassen haben“, sagt der Physiker Nicolas Wöhrl, der seine unterhaltsamen Experimente immer wieder auch auf Bühnen vorführt. Wöhrl und Remfort, die auch augenzwinkernd als „Rockstars der Wissenschaftskommunikation“ auftreten, erreichen mittlerweile ein beachtliches Publikum. Sein Professor, sagt Wöhrl, sei begeistert von „Methodisch inkorrekt“ – die „offizielle“ Uni und ihre Öffentlichkeitsarbeiter hätten die Podcaster hingegen links liegen lassen.
„Die Wissenschaft hat es ein Stück weit verpasst, auch die Herzen zu erreichen“, sagt Patrick Breitenbach. Religionen oder Ideologien schafften dagegen Storytelling, eine Art emotionale Welterzählung. Mit seinem „Soziopod“, der sich gesellschaftsrelevanten soziologischen und philosophischen Themen widmet, wollten er und sein Kollege Nils Köbel die Zuhörer nicht nur intellektuell, sondern auch auf der Gefühlsebene ansprechen. „Die Wissenschaft“, sagt Breitenbach, „hat die Welt entzaubert.“ Mit ihrem Podcast wollten sie der Wissenschaft ein wenig Zauber zurückgeben.

 Podcast-Hören per App](/sites/default/files/styles/large/public/img_0690.jpg?itok=DJ0AUDsu)