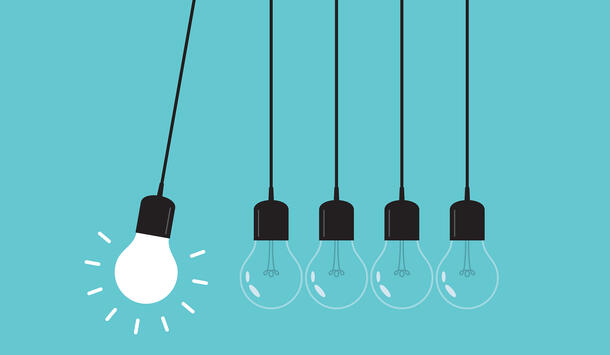Das war ein Schreck neulich: Wolfgang Heckl war auf dem Weg durch München, als er aus dem Autofenster plötzlich sah, wie Handwerker einen schweren Spielautomaten aus einer Kneipe zum Container wuchteten. Sofort stieg Heckl auf die Bremse und ging auf die Männer los: „Das geht doch nicht! So ein schönes elektromechanisches Instrument, das kann man doch nicht wegschmeißen!“ Jetzt steht der alte Automat in einer Ecke von Heckls Büro, er hat ihn eigenhändig repariert und auf Hochglanz poliert.
Wissenschaftskommunikation
Der Universalist

Experimente in der Oberpfalz
Diese Geschichte führt rund sechs Jahrzehnte zurück in den oberpfälzischen Ort Parsberg und sie beginnt mit einem Perpetuum mobile. „Meine Eltern waren keine Akademiker, aber mein Vater hatte immer eine Reparaturwerkstatt im Keller“, erinnert sich Wolfgang Heckl. Als er sechs Jahre alt war, verkroch er sich dort wochenlang und tüftelte an einer Maschine, die sich selbst immer weiter in Gang halten sollte (ein Perpetuum mobile, von dessen Unmöglichkeit nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik er damals nichts wusste). Ein Dynamo bildete ihr Herzstück, den der junge Tüftler über allerlei Stromdrähte und eine Antriebskette mit einem Elektromotor verband. „Aber was auch immer ich versuchte, die Idee, dass der Dynamo den Elektromotor antrieb und dieser wiederum den Dynamo, wollte nicht gelingen“, sagt Wolfgang Heckl, und er lacht laut über die Anekdote, in der die Wurzeln seines Wissensdurstes liegen.
„Uns kommen die Menschen abhanden, die in Zusammenhängen denken können und nicht nur aus ihrem Spezialgebiet heraus agieren.“

Dort in der Oberpfalz spielte auch die Geschichte mit seinem Physik- und seinem Mathelehrer: Der Mathelehrer war Hobbypilot und nahm den wissbegierigen Burschen aus seiner Klasse immer wieder mal mit auf den Flugplatz, wo sich alle möglichen physikalischen Gesetze anschaulich erklären lassen. Und auch der Physiklehrer prägte den jungen Wolfgang Heckl so nachhaltig, dass der schließlich nach seinem Abitur mit dem spektakulären Notendurchschnitt 0,8 stets entschieden den Kopf schüttelte, wenn wieder einmal jemand sagte, dass er mit einem solchen Abitur ja sicherlich Medizin studieren werde.
Heute bewegt er sich im Deutschen Museum wie in seinem Wohnzimmer, einzig mit der kleinen Besonderheit, dass es 25.000 Quadratmeter misst. Ein eigenes Bergwerk gehört dazu, ein Saal mit Schiffen und einer mit Flugzeugen, dazu zwei Sternwarten und ein Planetarium; um Starkstromtechnik geht es, um Pharmazie, um Virtual Reality. Wolfgang Heckl geht immer noch mit aufmerksamem Blick durch die Ausstellung, die Leute vom Ausstellungsdienst nicken ihm höflich einen Gruß zu und manchmal geht er auf Besucher zu und grüßt sie per Handschlag. „How are you doing“, ruft er dann, sie unterhalten sich ein bisschen, und im Weitergehen erklärt er, dass das ein Museumskollege aus Italien vom Leonardo-da-Vinci-Museum in Mailand gewesen sei. Kurze Zeit später trifft er eine Kollegin vom Musée des Arts et Métiers aus Paris. „You look younger than the last time we met“, sagt er nach dem Austausch von Wangenküsschen. Auch das gehört zu seinem Posten: Wolfgang Heckl ist ständig in der Welt unterwegs, um Kontakte zu knüpfen, um Neuigkeiten auszutauschen und Trends aufzuspüren, und fast täglich ist umgekehrt jemand zu Gast im Münchner Museum. Vor ein paar Tagen war die Bildungsministerin aus Berlin mit ihrer Familie bei ihm im Büro, erzählt Heckl, und in ein paar Stunden hat er seinen nächsten Termin in einem Münchner Ministerium.
Forscher, Rocker, Maler
Es ist dieser Trotz, der nicht nur das Museum charakterisiert, sondern auch Heckl selbst. Er bewundert die großen Universalgelehrten, die ihre Forschung auf etlichen Gebieten parallel vorantrieben, und sein eigener Werdegang ist von dieser Vielseitigkeit ebenfalls geprägt. Bevor er 2004 Direktor des Deutschen Museums wurde, forschte er als Professor für Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Department für Geo- und Umweltwissenschaften – eine Position, die Nano- und Geowissenschaften mit Biologie und Physik verbindet. Er singt in einer Rockband, er malt Acrylbilder zu naturwissenschaftlichen Phänomenen, einmal pro Woche geht er Volleyballspielen, er pflegt seine Sammlung von alten mechanischen Geräten, er hat ein Buch über die Kultur der Reparatur geschrieben und eins über die Wissenschaftskommunikation. „Uns kommen die Menschen abhanden, die eine Gesamtschau der Dinge haben, die in Zusammenhängen denken können und nicht nur aus ihrem Spezialgebiet heraus agieren“, sagt Wolfgang Heckl.
Wenn er zurückdenkt an seine Versuche mit dem Perpetuum mobile, wurmt es ihn, dass er dem Phänomen erst bei seinem ersten Besuch im Deutschen Museum nähergekommen ist. Wolfgang Heckl lacht und winkt ab: „Das, was ich damals mit sechs Jahren nicht herausfinden konnte – welche Naturgesetze ein solches Perpetuum mobile also unmöglich machen –, das kann jeder Besucher hier im Museum selbst entdecken.“
Wieder ein Kreis im Leben von Wolfgang Heckl, der sich geschlossen hat.
Über diese Serie
20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.