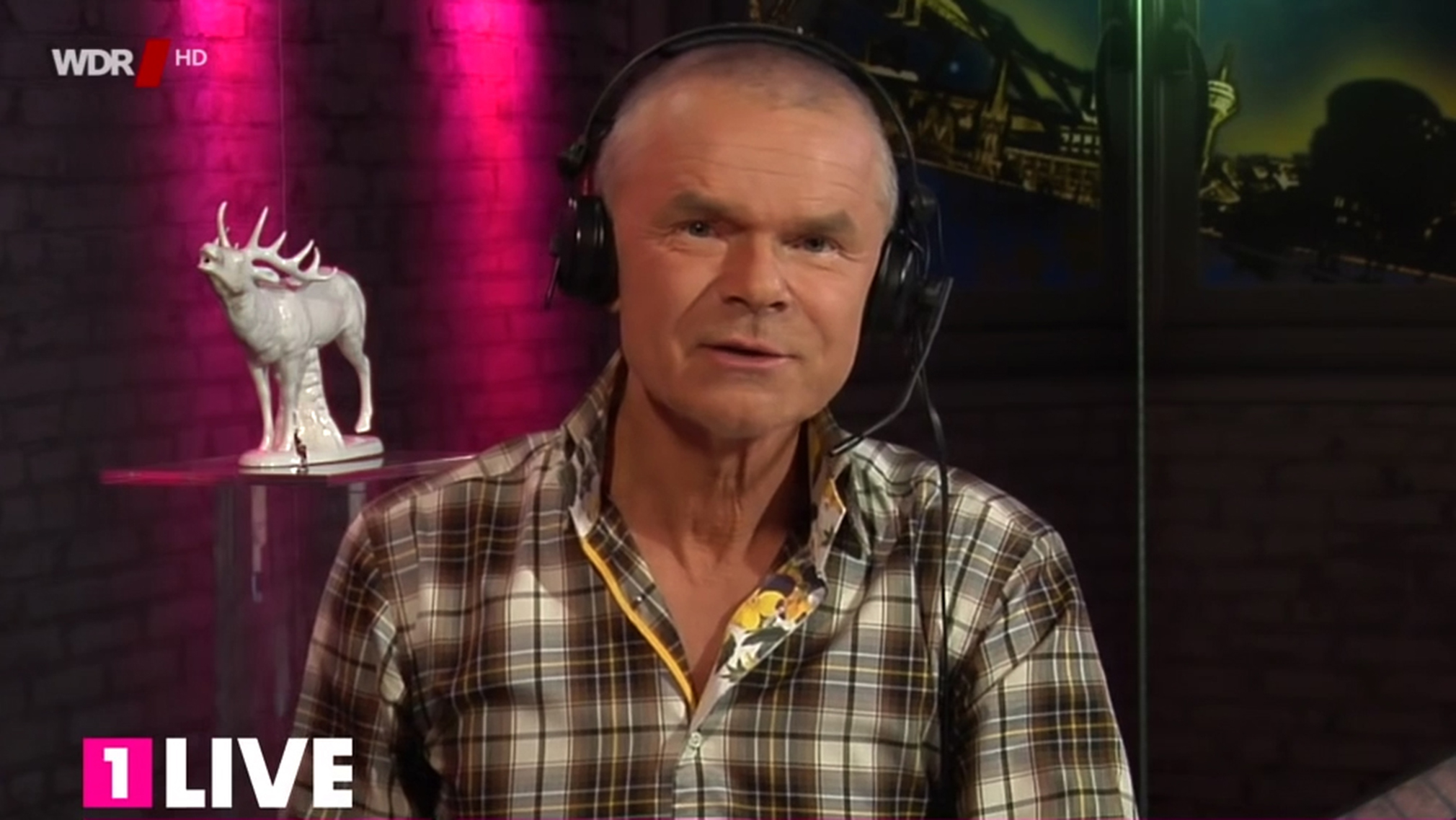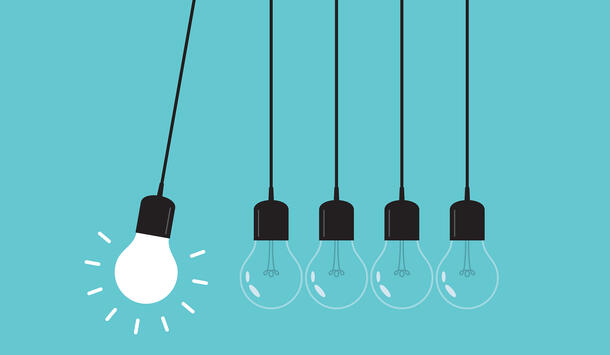Da ist es also, das Ende des Aufklärungszeitalters, das antiintellektuelle Zeitalter. Die postfaktischen Zeiten sind angebrochen. Und es zieht ein Jammern und Wehklagen durch die intellektuelle Welt: Was nur tun, wenn „die Gesellschaft“ auf einmal nicht mehr glaubt, was auf Erkenntnissen beruht?
Haben sich die Menschen wirklich auf einmal mehrheitlich in ihrer Rezeption von Nachrichten und wissenschaftlichen Erkenntnissen verändert? Verweigern sie wirklich wie von Zauberhand plötzlich die Anerkennung von Expertenwissen oder ganz banalen Wahrheiten wie jener, dass die Erde rund ist? (Hierzu äußerte sich jüngst jemand bei Jürgen Domian und machte diesen fast sprachlos.)
Wissenschaftskommunikation
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt
 Ausschnitt, [CC BY-SA 4.0](https:https://creativecommons.org/licenses/by-sa) image](/sites/default/files/styles/1080x607/public/c._flammarion_-_universum_-_paris_1888_-_colored_heliocentric_panorama.jpg?itok=T0paWir0)
Fakten vs. Emotionen
Dass Emotionen in der Nachrichtenrezeption wichtig sind, ist ein alter Hut unter Journalisten. Für die reine Kurznachricht zu einer neuen wissenschaftlichen Erkenntnis genügen Fakten. Wenn wir aber wirklich vermitteln wollen, brauchen wir Protagonisten, Betroffene, eine emotionale Brücke zu den Lesern. Die Betroffenen können im Falle von medizinischen Therapien Patienten sein. Sie sind in Wissenschaftsreportagen aber oft die Experten selbst, die Wissenschaftler. Und diesen fällt es häufig extrem schwer, sich von Fakten zu lösen und über ihr Feld auch emotional zu berichten. Das liegt zu einem sehr großen Teil am notwendigen und wichtigen Sozialisationsprozess als Wissenschaftler. So erlernen Studierende Semester für Semester immer mehr von der für ihr Gebiet wesentlichen Fachsprache. Außerdem erlernen sie exakt, präzise und wissenschaftlich zu arbeiten. Das bedeutet Objektivität, rationales Handeln, sachliche Conclusio. Es sind keine emotionalen Ergebnisse erwünscht. Einzig was zählt, sind die Fakten.
Dies lässt uns denken, dass die Wissenschaften und damit auch die handelnden Personen stets rein sachlich sein müssten und seien. Natürlich kennzeichnet erfolgreiche Wissenschaftler aber auch, dass sie leidenschaftlich für ihr Thema brennen. Sie sind genauso Menschen mit Emotionen. Sie mögen bestimmte Theorien oder Forschungsansätze und andere nicht. Es gibt auch hier Ablehnung und Begeisterung. Und sie haben Intuition – und manchmal Glück. Davon etwas zu zeigen, könnte die Wahrnehmung von Erkenntnissen stärken. Wie also wäre es, wenn Forschende durchaus mehr Forschungsgeschichten erzählten und auch die eigene Begeisterung oder die eigenen Bedenken zeigten?
„Mensch. Haltung. Geschichten. Solche Elemente können die Wahrnehmung von Fakten aus der Wissenschaft in der Gesellschaft stärken. “