Dass der Link ein zentrales Merkmal des Internets ist, ist eine Banalität. Umso mehr verwundert es, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seinem jüngsten Urteil daran gewissermaßen rüttelt, denn für bestimmte Fallkonstellationen soll Verlinkung nicht mehr zulässig sein. Viele sprechen daher von einer „Bedrohung von Grundfunktionen des Internets“ (wie Netzpolitik hier), das kann aber nicht an sich schon ein Argument sein: Eingriffe in Dinge kommen ständig vor und ständig werden Menschen durch Regulierung Handlungsweisen verboten. Wer sich gegen ein Tempolimit und Ampeln etwa wegen „Eingriffen ins Autofahren“ wehren würde, müsste doch noch ein paar Argumente mehr vorbringen, um seine Gegner zu überzeugen. Anders ist es für die, die das Internet mit Cyberspace-Ideologie oder als „kollektives Bewusstsein“ der Menschheit zu einem Heiligtum erklären – solche Leute gibt es ja. Gehen wir also der Sache auf den Grund – und dabei seien ganz bewusst die üblichen juristischen Hinweise auf Linkfreiheit (Paperboy-Urteil des Bundesgerichtshofes, das in Verlinkung keine Veröffentlichung oder Vervielfältigung sah) oder auf etliche kritische Einzelurteile ausgeklammert. Recht kann Ordnung, Verbindlichkeit und Frieden schaffen, aber soziale, kulturelle, wirtschaftliche und andere wertende Begründungen nicht ersetzen.
Linkfreiheit – Worum es dabei geht
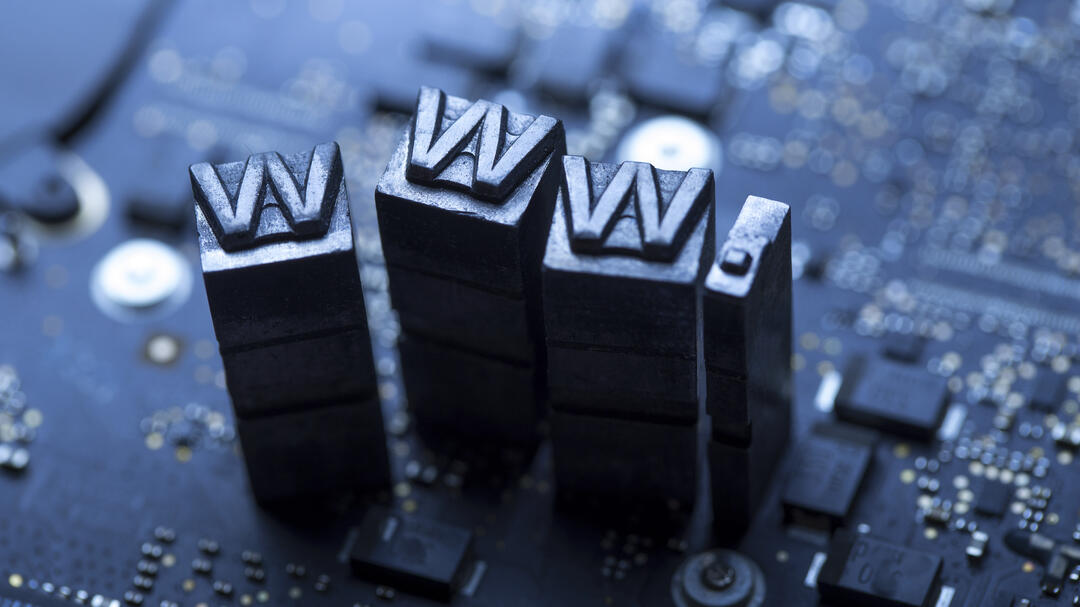
Denn die Beteiligten wissen nichts von der ganzen Personenstruktur (einem sehr großen Netzwerk mit ganz verschiedenen Knotentypen), sie haben keine Rechtsnormen für ihre Tätigkeit, sie treffen sich nicht physisch und sie haben keinen Raum, selten haben sie einen gemeinsamen Zweck, ein großes Ganzes zu erschaffen. Begrifflich ist das eben schwer als Organisation zu fassen, allenfalls vielleicht noch als eine maximal entgrenzte, maximal lose Organisation – Schrödingers Organisation gewissermaßen, die sich bei ihrer Betrachtung auflöst. Was diese „Unorganisation“ zusammenhält, ist eine soziale Praxis, die durch den Link und das Handeln mit ihm vermittelt wird. Der Link ist das zentrale Artefakt einer sozialen Praxis, die aus Handlungen, Texten und eben Links besteht.
So entsteht aus Einzelteilen ein neues Ganzes, nämlich ein Web, das mehr als die Summe seiner Teile ist: Es entsteht ja nicht einfach nur eine Struktur verlinkter Dokumente, es entsteht eine höhere (emergente) Struktur: Was ist wichtig, worüber wird geschrieben und – in einer „social“ Dimension – wer schreibt worüber und worauf genau bezieht er sich? Links sind Markierungen für Relevanz, sind Aufmerksamkeitsmarkierungen. So verbinden Links nicht nur Dokumente, sondern auch Personen. Ohne Links lässt sich Wissen weit schlechter organisieren – und ohne Links würde auch die andere Zugriffsmethode, die Suchmaschine, nicht operieren können. Und zwar nicht nur, weil die Suchmaschine auf der Suchergebnisseite die Trefferseiten verlinkt, sondern auch, weil sie das Web über Verlinkungen erschließt und vor allem durch Verlinkungen die Relevanz bewertet. Dabei sind ja auch die sogenannten sozialen Signale an Suchmaschinen nicht nur Personenstruktur, sondern eben auch auf Social Media geteilte Links. Kurz gesagt: Der Link ist ein unabdingbares Merkmal zur Zugänglichmachung und Ordnung großer Dokumenträume, und das geht natürlich nur, weil der Link maschinenlesbar ist.
Eselsohren markieren Relevanz
Wer nun den Link gleich heiligt, sei gewarnt: Ganz so revolutionär ist das Web nicht. Nicht nur, dass Hypertext schon ein bisschen älter ist als Tim Berners-Lees CERNStunde 1989; er entsteht 1945 als Konzept im „Memex“-System von Vannevar Bush und wird 1965 von Ted Nelson in Softwarebibliotheken in seinem „Xanadu“ implementiert. Es gab immer schon Fußnoten und Endnoten und andere Verweissysteme in der Schriftkultur. Mit dem Buch als Verkörperung eines Textes wurde dieser Text als Ganzes überhaupt adressierbar. Die Relevanz eines Textes markierten Eselsohren, abgegriffene Buchrücken, herausgerissene Seiten und der Standort in der Bibliothek. Die Umsetzung im Digitalen, die Standardisierung in HTML und die Maschinenlesbarkeit, welche die Grundlage für algorithmische Verfahren für Suche und Relevanz und dergleichen ist – diese drei beziehungsweise vier Gesichtspunkte machen jedoch den Link zur vorläufigen Krönung der Geschichte, der eigentlich nur dadurch ein Zacken in der Krone fehlt, dass der Link immer noch kaputtgehen kann, weil das referenzierte Dokument nicht zugänglich ist.
Ganz unabhängig von Text, sozusagen im Text selbst, innerhalb von Texten und „zwischen“ Texten entstehen Beziehungen, Strukturen und Leseflüsse, besonders ausgeprägt bei James Joyces Ulysses, Arno Schmidts „Zettels Traum“ und vielerlei experimenteller Literatur. Intertextualität ist eine Grundeigenschaft von Texten: Wer Sprache benutzt, bezieht sich auf Texte. Zitate, Plagiate, Anspielungen sind die plakativsten Beispiele. Sprache ist ein „Spannungsfeld“, in dem Schreibender und Lesender schon durch die Wortwahl in Interaktion mit anderen Texten sind. „Der Text ist ein Gewebe von Zitaten aus unterschiedlichen Stätten der Kultur“, schreibt Roland Barthes zur Intertextualität (mehr hier und hier).
„Wer nicht weiß, ob er verlinken darf, muss googeln, lesen, einen Anwalt befragen – all dies wird der Verlinkungskultur schaden. “
Was Organisation betrifft, gibt es auch traditionelle Fälle eines gewachsenen Zusammenwirkens, die lange vor dem Link existierten. Das ist etwa das Steinmännchen, mit dem Wanderer die Wege markieren; eine Kulturtechnik, die dem Verlinken insofern ähnlich ist, als es einer Jedermann-Fähigkeit bedarf, um in „unorganisiertem“ Zusammenwirken Wissen zu pflegen und sogar etwas logisch Höheres zu markieren, den „Weg“.
Es sei dahingestellt, ob man mit Vannevar Bush an die assoziative Denkweise des Menschen anknüpft oder an Textbeziehungen in Poststrukturalismus und Literaturwissenschaft oder an moderne Ideen von Organisationssteuerung. Der Link ist jedenfalls nicht einfach ein Textstil oder ein Button, er ist die jüngste Erscheinungsform von Strömungen, die hierarchische Ordnung durch (selbststeuernde) Heterarchie, die feste Linearität durch Assoziativität und das zeitliche Nacheinander durch eine gewisse Synchronizität ergänzen. Vielleicht ist es inzwischen sogar umgekehrt, die durch Links geschaffene Struktur prägt unsere Vorstellung von Wissenszugang und -organisation so stark, dass diese Denkweisen begünstigt werden.
Ausgerechnet die Freunde des Freihandels
Zum einen stellt jede rechtliche Einschränkung eine Barriere für die Kultur des Verlinkens dar. Wer nicht weiß, ob er verlinken darf, muss googeln, lesen, einen Anwalt befragen – all dies wird der Verlinkungskultur schaden. Das Urteil des EuGH, das sich nur auf kommerzielle Nutzung bezieht und obendrein auf einen Sachverhalt, bei dem der Verlinkende wider besseres Wissen ein zweites Mal einen Link auf rechtswidrige Veröffentlichung setzte, ist aus meiner Sicht wertungsmäßig gut nachvollziehbar. Diese Art der absichtlichen Verlinkung schädigt andere und dies nur, damit der Verlinkende selbst einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt. Trotzdem muss man davor warnen, diese Rechtsprechung auszudehnen, wie man auch davor warnen muss, ein Leistungsschutzrecht durchzusetzen, das sich gegen private Nutzer richtet. Es schädigt die Gesellschaft in ihrer Kulturtechnik der Verlinkung, weil es Barrieren schafft. Die moderne Technikgeschichte ist voller Beispiele von Innovationen, die Barrieren abgeschafft haben, etwa die Weltpostvereinigung mit einheitlichen Gewichtsklassen. Die Globalisierung ist voller Abschaffung von Sonderfällen, Hürden und Abweichungen, die jeder Freund des Freihandels sich wünschte. Umso verwunderlicher ist es nun, dass ausgerechnet Freunde des Freihandels nun Verlinkungsbarrieren das Wort reden. Das kann und wird in der technosozialen Dynamik entweder nicht funktionieren oder der Kultur schaden.
Zum anderen ist die Linkfreiheit selbstverständlich eine Form der grundgesetzlich garantierten allgemeinen Handlungsfreiheit, sie ist aber auch ein Kern der Meinungsfreiheit: Kritik als ein Motor der demokratischen Öffentlichkeit und Kritik von irgendjemandem an irgendjemandem setzt voraus, dass der Kritisierte genannt und seine Einlassung wenigstens adressiert werden kann. Eine Kritik ohne Kritisierten ist denklogisch nicht möglich. Wer sich das neben der kulturellen Bedeutung des Links für das kollaborative Zusammenwirken und für die Wissensorganisation und den Zugang zu Wissen vor Augen führt, der muss den Link zwar nicht für heilig erklären; er wird aber sehr vorsichtig sein, seine Benutzung irgendwie zu regulieren oder einzuschränken. Wer das in Erwägung zieht, sei es zum fragwürdigen Vorteil von Verlagen oder um seine Vorstellung von Mitverantwortung durchzusetzen, muss sich selbst massive Kritik gefallen lassen.

