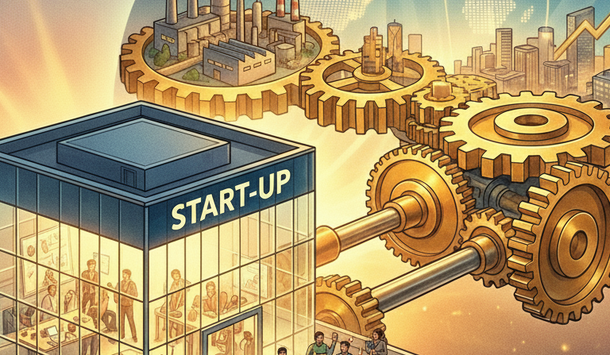Scheinbar vertraute Gegenstände entwickeln plötzlich völlig neue Eigenschaften: Metalle werden elastisch, Sand wird wasserfest und verunreinigtes Wasser magnetisch. Die Forschung an Nanoteilchen wird die Welt verändern. Und deshalb braucht es Forscher mit viel Fantasie, die heute schon an diesen Veränderungen arbeiten. Einer von ihnen ist der Chemiker und Nanoforscher Karl Mandel. Ein Senkrechtstarter, der inzwischen hart im Forschungsalltag gelandet ist.
Mandel hat eine Zeit lang in Oxford studiert, mit 27 Jahren bekam er seinen ersten Forschungspreis. Für seine Doktorarbeit gelang es ihm und seinem Team, Abwasser mit speziellen magnetischen Partikeln zu versehen. Mit einem Magnet ließen sich anschließend zum Beispiel Phosphate herausfiltern. So wurde das Wasser gereinigt und die herausgefilterten Stoffe konnten wiederverwendet werden, zum Beispiel als Dünger. Eine geniale Erfindung, mit der Kläranlagen zu Rohstoffquellen der Zukunft werden könnten. Heute leitet Mandel eine Forschungsgruppe am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC in Würzburg.
Innovationssystem
Ein Friedhof der Ideen

„„Spätestens nach der dritten Ablehnung eines Förderantrags verfolgt man eine Idee nicht länger“ “

Die meiste Zeit verbringe er inzwischen mit Forschungsanträgen, sagt Mandel, nur etwa jeder zehnte Antrag habe Erfolg: „Ich habe inzwischen einen eigenen Friedhof mit abgelehnten Ideen.“ Wenn sogar große Talente wie Karl Mandel langsam den Mut verlieren, zumal in einem Bereich der Spitzentechnologie, dann ist es Zeit, sich zu fragen: Wer bestimmt eigentlich, was in diesem Land erforscht wird? Gibt es eine Forschungsagenda? Wenn ja, wer legt sie fest? Und welche Themen fallen hinten runter?
Das Forschungssystem in Deutschland ist plural und wird von unterschiedlichen Interessen und Geldgebern bestimmt. Zwar steckt die öffentliche Hand seit Jahren mehr Geld in Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig müssen jedoch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen immer häufiger in Wettbewerben um dieses Geld konkurrieren. Die größten Geldgeber in diesem Bereich der „Drittmittel“ sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Bund und die Wirtschaft.
Die Gralshüterin der freien Forschung ist die DFG. Eine Forschungsagenda gebe es hier nicht, erfährt man auf Anfrage: „Wir fördern nur das, was wissenschaftlich innovativ ist und sich im Wettbewerb als sehr gut behauptet“, sagt Annette Schmidtmann, die bei der DFG für fachliche Fragen der Forschungsförderung verantwortlich ist. Förderanträge werden von führenden Wissenschaftlern des eigenen Fachs bewertet. Bei der DFG entscheidet gewissermaßen die Wissenschaft selbst darüber, was sie erforschen will. Politische oder wirtschaftliche Kriterien sollen hier keine Rolle spielen.
Der Bund fördert außerdem die großen Forschungsgesellschaften. Sie arbeiten unabhängig und sollen sich gegenseitig ergänzen. Die Max-Planck-Gesellschaft etwa widmet sich eher der Grundlagenforschung, die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet eng mit der Wirtschaft zusammen. So soll Vielfalt im System gewährleistet bleiben. Auch wenn Kooperationen mit der Wirtschaft besonders bei Universitäten häufig kritisch gesehen werden – insgesamt gesehen geht der Anteil der Drittmittel aus der Industrie zurück, während die Mittel des Bundes in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen sind.
Dass die Zahl der Förderungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren zugenommen hat, beobachtet auch der Nanoforscher Karl Mandel. Allerdings gebe es inzwischen immer mehr Einrichtungen, die um die begehrten Drittmittel buhlen. Neben den Universitäten seien das inzwischen zunehmend Fachhochschulen und immer neue Forschungsinstitute.
Themenpragmatismus und Herdentrieb
Durch diesen strukturellen Wandel entstehe bei vielen Wissenschaftlern ein klarer „Themenpragmatismus“, so Mandel weiter. Spätestens nach der dritten Ablehnung eines Forschungsantrags verfolge man so manche gute Idee nicht weiter und wende sich anderen Themen zu, die eher gefördert werden. Darin liegt die vielleicht größte Gefahr derzeit: Die Forschungslandschaft wächst, gleichzeitig nimmt aber der wissenschaftliche „Herdentrieb“ zu, weil Universitäten und Forschungsinstitute zunehmend auf Drittmittel angewiesen sind, sei es von der DFG, dem BMBF oder der Wirtschaft.
Sogar bei der Forschung selbst kommen Profiforscher und Laien sich langsam näher. So erlebt das zumindest Lisa Pettibone. Sie arbeitet beim Berliner Museum für Naturkunde, wo sie Bürgerwissenschaftsprojekte aus ganz Deutschland zusammenbringt, Projekte also, bei denen sich Bürger direkt an wissenschaftlicher Forschung beteiligen. Seit 2014 kann sich jeder Interessierte auf der Onlineplattform des Projekts über Möglichkeiten der Mitarbeit informieren.
„In den USA haben sich Bürgerwissenschaften besser etabliert. Die Forschung dort ist nicht so abhängig von Drittmitteln.“
Eines von Pettibones Lieblingsbeispielen ist das österreichische Projekt „Reden Sie mit“. Hier können interessierte Bürger sich an der Erforschung psychischer Krankheiten beteiligen. Zwei Monate lang konnten sie Themen vorschlagen, mit denen sich die Forschung mehr beschäftigen sollte. Viele wünschten sich zum Beispiel mehr Wissen darüber, wie psychische Krankheiten bei Kindern früher erkannt werden können – ein Bereich, der bisher nur wenig erforscht wurde. Nun soll eine Forschergruppe diese Ideen zusammen mit den Projektteilnehmern erforschen. Mit solchen Projekten könnten Bürger in Zukunft direkt helfen, den einen oder anderen blinden Fleck der Wissenschaft aufzudecken.
Forschungswende
Mehr Mitsprache bei der Forschung – das fordert die Initiative „Forschungswende“. Die Zivilgesellschaft sollte stärker in Forschung und Entwicklung mit einbezogen werden als bisher. Dies gelte sowohl für die Themenwahl als auch für die Vergabe der Mittel. Unterstützung erfährt die Initiative aus der Bevölkerung: Beim Wissenschaftsbarometer 2016 forderte knapp jeder zweite Befragte, dass die Bürger entscheiden sollten, wofür Geld in der Forschung ausgegeben wird.