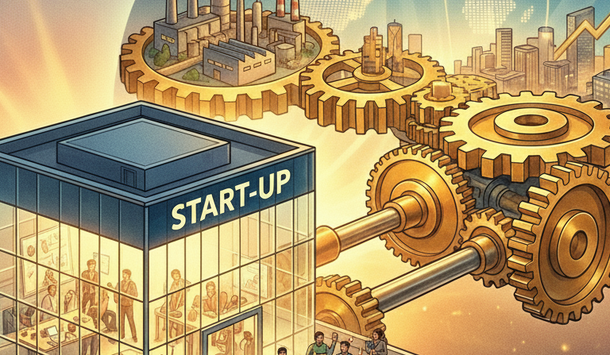Wie aber lässt sich Deutschland in Sachen Innovation zurückführen auf die Überholspur? Mit dieser Frage beschäftigt sich Volker Meyer-Guckel intensiv, der Generalsekretär des Stifterverbandes. Sein Ansatz: „In Deutschland denken wir fast immer in Projekten. Stattdessen sollten wir das ganze Innovationssystem in den Blick nehmen.“ Statt immer neuer Projektförderung brauche man eine Strategie für das große Ganze – mit Querverbindungen von Disziplinen und Sektoren. Forschung, Innovation und Transfer gehören zusammen, Innovations- Industrie-, Finanz- bis hin zur Rohstoffpolitik müssen aus einem Guss sein, Öffentliche Forschung und Wirtschaft enger zusammenarbeiten. „Im vergangenen Jahr sind fast alle Nobelpreise für die Naturwissenschaften an Google-Mitarbeiter gegangen“, sagt Volker Meyer-Guckel: „Das zeigt, dass es neue Gemeinschaften von Wissensproduktion gibt.“ Sein Appell ist es, groß zu denken – nicht mehr nur die Forschung zu unterstützen, sondern auch das gesamte Drumherum von Investoren, innovationshungrigen Unternehmen, Startups und auch Stiftungen und Philantrophen im Blick zu behalten Diese Gesamtheit der Akteure ist es, die Meyer-Guckel mit dem Begriff des Innovationssystems meint – und genau das steht auch auf dem Programm des Gipfels für Forschung und Innovation, zu dem der Stifterverband die Top-Fachleute aus den betroffenen Feldern zusammenbringt (siehe Kasten).
Wer sich in der Praxis anschauen will, wie sich Innovation ganz konkret fördern lässt, kann nach Heilbronn fahren. Wenn Reinhold Geilsdörfer in der Stadt unterwegs ist, sieht er an allen Ecken und Enden, dass etwas Großes in Bewegung geraten ist. Geilsdörfer ist Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung, früher war er Hochschulpräsident – und jetzt steht er im Zentrum einer spektakulären Entwicklung. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Heilbronn zu einem Zentrum für Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit auszubauen.
„Der erste große Wendepunkt war im Jahr 2018, als die Technische Universität München bei uns einen Campus eröffnet hat“, erinnert sich Reinhold Geilsdörfer. Zu Innovation, Management und Technologie forschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seither auch in Heilbronn – und rückten die Stadt damit in den Fokus von anderen Institutionen. Seit diesem Jahr baut die Max-Planck-Gesellschaft zwei Abteilungen im Bereich innovativer Medizinforschung auf, zudem eröffnet die ETH Zürich 2026 einen Campus in Heilbronn. Und mit jeder dieser Institutionen entsteht ein ganzes Stück mehr von der kritischen Masse, die nötig ist, um Innovationen hervorzurufen: Es reichen eben nicht ein paar vereinzelte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nötig ist ein regelrechtes Ökosystem. Inzwischen hat Geilsdörfer mit seinem Team Stiftungsprofessuren in Oxford, in Stanford, in Singapur und an anderen Spitzenunis eingerichtet, die allesamt mit Heilbronn in engem Austausch stehen und Kooperationsvereinbarungen beinhalten. Derzeit bauen die Unternehmen der Schwarz-Gruppe, die Dieter Schwarz Stiftung und das Land Baden-Württemberg sowie weitere Partnern den Innovation Park Artificial Intelligence, ein 30 Hektar großes Quartier für 5.000 Menschen, die an Entwicklung und Anwendung von KI arbeiten.
Und auf einmal entsteht eine regelrechte Sogwirkung: Etliche Unternehmen haben inzwischen Entwicklungszentren in Heilbronn aufgebaut, sie suchen die Nähe der Spitzenforschung – und setzen eine Aufwärtsspirale in Gang: Weitere Top-Talente ziehen in die Region, Investoren entdecken hier Chancen und aus den Forschungseinrichtungen entstehen Ausgründungen. Wenn die Einschreibungen für das neue Semester beginnen, laufen in Heilbronn allein für die 600 Studienplätze am Campus der der TU München 3.700 Bewerbungen ein, die meisten davon aus dem Ausland.