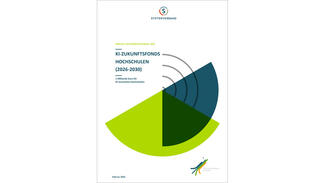Deep Tech
Wertschöpfungspotenziale für die deutsche Innovationswirtschaft heben

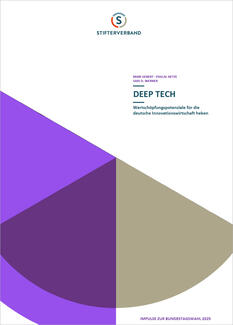
Die aktuelle wirtschaftliche Krise Deutschlands ist nicht vorrangig konjunkturell bedingt, sondern hat tiefliegende strukturelle Ursachen. Industriebranchen, die lange für hohe Wertschöpfung gesorgt haben, verlieren an Bedeutung und Wettbewerbsfähigkeit. Neu entstehende Branchen mit Wachstumskernen in Deutschland sind kaum erkennbar. Viele internationale Vergleichsstudien zeigen die stagnierende Innovationsfähigkeit Deutschlands.
Mit Blick auf die Stärke Deutschlands als exportorientierte Volkswirtschaft darf einerseits der Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit bei Schlüsseltechnologien sowie andererseits die stagnierende Entwicklung von Marktanteilen forschungsintensiver Waren als alarmierend gelten. Hinzu kommen seit Jahren steigende Innovationshemmnisse, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen betreffen. Das macht deutlich: Deutschlands Innovationswirtschaft selbst steckt in der Krise.
Woran liegt das? Klar ist, dass Deutschland seine vorhandenen komparativen Stärken im Forschungs- und Innovationssystem zu wenig nutzt: führende Wissenschaftseinrichtungen mit großer Kompetenz in der naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagenforschung sowie eine noch immer starke industrielle Basis. Die Verbindungen zwischen diesen Bereichen werden gemeinhin als Deep-Tech-Innovationen bezeichnet. Dabei handelt es sich um forschungsintensive Entwicklungen mit hohem Technologieanteil, die zur Klasse des innovationsgetriebenen Unternehmertums gezählt werden. Diese Unternehmen legen einen Fokus auf Disruption und globale Märkte, wodurch sie deutlich größere Wachstumspotenziale als traditionelle, linear wachsende Start-ups aufweisen. Aktuelle Berichte von Münchner Kreis und Startup-Verband haben zuletzt die strategische Bedeutung von Deep Tech für Deutschlands Innovationssystem hervorgehoben und mögliche Handlungsfelder sowie förderliche Rahmenbedingungen analysiert. Dabei wird deutlich, dass Deep Tech ein Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche und technologische Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist. Dieser erfordert jedoch neben einer gezielten Verankerung in der Forschungs- und Innovationspolitik von Bund und Ländern vor allem innovationspolitische Interventionen. Diese werden im Folgenden beleuchtet. Das Impulspapier legt ferner dar, aus welchen Gründen und mithilfe welcher Strategien eine neue Bundesregierung diesem Innovationsfeld mehr Aufmerksamkeit widmen sollte.
Das im Februar 2025 vom Stifterverband veröffentlichte Impulspapier zur Bundestagswahl 2025 zeigt zentrale Herausforderungen für das deutsche FuE-System und seine Akteure auf und formuliert gezielte Handlungsempfehlungen an die neue Bundesregierung, um die Innovationsfähigkeit Deutschlands zu beschleunigen und Transferbarrieren gezielt abzubauen. Diese Empfehlungen sind Ergebnis eigener Analysen und zahlreicher Interviews mit Experten und Expertinnen aus Hochschulen, Innovationsforschung, Unternehmen, Verbänden und Start-ups.
Handlungsempfehlungen
Die mangelhafte Datengrundlage zu Deep Tech in Deutschland erschwert die systematische Erfassung seiner strategischen und wirtschaftlichen Bedeutung. Ohne präzise Kriterien bleiben die Entwicklung passgenauer Fördermaßnahmen und die Evaluierung bestehender Instrumente schwierig. Eine gezielte, strategisch ausgerichtete Förderung setzt jedoch fundierte Kenntnisse über spezifische Stärken, Schwächen, Herausforderungen und Potenziale bei Forschungsbedarfen und Entwicklungsdynamiken voraus. Dafür braucht es bessere Datengrundlagen in Deutschland. Beispielsweise fehlen detaillierte Informationen über Herkunft, Themenschwerpunkte, Art der Finanzierung und regionale Dynamik von Deep-Tech-Gründungen. Außerdem gibt es wenige Informationen darüber, wie viele Gründungen auf den unterschiedlichen Stufen scheitern. Ebenso unzureichend erfasst sind Netzwerkstrukturen und relevante kommerzielle Kooperationen zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen. Eine systematische Identifikation von Markt- und Skalierungsbarrieren ist dringend notwendig, ohne eine bessere Datenlage jedoch nicht realisierbar. Zudem braucht es Initiativen, die die starke Grundlagenforschung und die industrielle Basis gezielt verknüpfen. Deep-Tech-Ansätze finden sich bisher stark verteilt an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Strategien der Bundesregierung und der Länder wieder. Der Begriff Deep Tech taucht dabei allerdings nur selten auf. Um dem speziellen Potenzial für Deutschland, aber auch den derzeit allgemeinen Standortherausforderungen gerecht zu werden, sollte Deep Tech für die politisch-strategische Implementierung von Förderlinien klarer definiert und in der Weiterentwicklung beziehungsweise Neujustierung von Regierungsstrategien sichtbar gemacht werden. Damit verbundene Förderlinien müssen den hier vorgeschlagenen Merkmalen von Deep Tech Beachtung schenken und Risikoperspektiven positiv integrieren, selbst wenn technologische Durchbrüche wegen der spezifischen Entwicklungszyklen nicht nach den initial vereinbarten Förderzeiträumen erreicht werden.
Deep Tech-Innovationen spielen eine zentrale Rolle in deutschen Schlüssel- und Zukunftsbranchen wie Cleantech, Biotechnologie und der chemischen Industrie, in denen mit erheblichen jährlichen Wachstumsraten zu rechnen ist. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, ist das Zusammenspiel von Grundlagenforschung, industrieller Basis und forschungsintensiven Start-ups zentral. Obwohl derartige Synergieeffekte vornehmlich auf regionaler Ebene entstehen, beispielsweise initial durch IP-Transferprozesse zwischen Hochschulen und Ausgründungen, mangelt es derzeit an effektiven öffentlichen Förderungen, die Kooperationen, Kapitalbeteiligungen und Beziehungen entlang regionaler Wertschöpfungsketten zwischen Deep-Tech-Start-ups, KMU, aber auch etablierten Unternehmen stärker fördern. Die Bundesregierung sollte die Entwicklung regionaler Innovationsökosysteme unterstützen. Spezielle Regulierungsräume, die durch steuerliche Gutschriften für Kapitalerträge langfristige Anreize für Investitionen in Deep Tech schaffen, sind dafür ein geeignetes Instrument.
In Deutschland existiert eine Vielzahl von Frühphasenprogrammen auf Bundes-, Länder- und Regional-ebene, die nicht verwässernde Kapitalressourcen bereitstellen. Allerdings fehlt es an staatlichen Instrumenten, die über die Frühphase hinausgehen und gezielt den Aufbau von Vermögenswerten oder die Finanzierung von Infrastruktur für Deep-Tech-Gründungen ermöglichen. Darüber hinaus stellt die in Deutschland stark fragmentierte und regulatorisch eingeschränkte private Kapitallandschaft ein Hindernis dar. Trotz zahlreicher Inkubatoren, Akzeleratoren und neuen vielversprechenden Programmen wie den Startup Factories fehlt es an Bündelung und kritischer Masse. Mit dem SPRIND-Freiheitsgesetz ist zweifellos der richtige Weg eingeschlagen worden. Im Vergleich zu ähnlich operierenden Innovationsagenturen und insbesondere bei der Förderung von Deep-Tech-Start-ups müssen ihre finanziellen Spielräume jedoch deutlich erhöht werden. Eine ähnliche Problematik zeigt sich beim Deep Tech and Climate Fonds. Dieser ist nicht nur mit zu wenig Kapital ausgestattet, sondern verengt seinen Förderbestand auf ausgewählte Deep-Tech-Domänen. Auch der Anteil privater Investitionen muss hier erheblich steigen. Die nächste Bundesregierung hat hier breiten Nachholbedarf.
Der Forschungsförderung in Deutschland ist es in den letzten Jahren durchaus gelungen, langen Atem zu beweisen und in relevanten Deep-Tech-Feldern die Entstehung von neuem Grundlagenwissen und sogar wissenschaftlichen Durchbrüchen herbeizuführen. Quanten-, Fusions- und natürlich die mRNA-Forschung sind hierfür nennenswerte Beispiele. Gleichzeitig wird zunehmend deutlich, dass die Skalierung und kommerzielle Verwertung von Forschungsleistungen im deutschen Innovationssystem nicht ausreichend gelingt. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist BioNTech, das trotz seiner weltweit führenden Forschung im Bereich der mRNA-Technologie auf internationale Kooperationspartner angewiesen war, um die Produktion, Vermarktung und den Vertrieb des COVID-19-Impfstoffs in großem Maßstab zu realisieren. Dies verdeutlicht, dass selbst bei technologischen Durchbrüchen oft entscheidende Schritte im Innovationsprozess – insbesondere bei der Markteinführung – außerhalb Deutschlands erfolgen. Gerade bei Deep Tech ist es daher essenziell, Forschungs- und Innovationsförderung stärker zusammenzudenken.
Ein Anwendungsfall ist hier auch die sicherheitsrelevante Forschung. Denn ein weiteres Innovationshemmnis bei der Finanzierung von Deep-Tech-Innovationen besteht in den in Deutschland relativ strikt getrennten Domänen ziviler und militärischer Forschung. Und das obwohl die militärische Forschung und Beschaffung seit langem eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Durchsetzung technologischer Innovationen spielt. Ohne militärische Forschung gäbe es beispielsweise kein iPhone. In jüngerer Vergangenheit wecken auch zivile Innovationen aus der Forschung immer häufiger Sicherheitsinteressen. So können Dual-Use-Innovationen die deutsche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität bei gleichzeitigen positiven Effekten für die Innovationswirtschaft fördern. Sicherheitsrelevante Forschung muss stärker in übergreifende Strategien eingebunden werden. Um Synergien zu schaffen und mehr Spillovers zu ermöglichen, müssen auch die institutionellen Gefüge der Forschungsförderung überdacht werden. Denn wichtige Institutionen für die Deep-Tech-Förderung wie die SPRIND besitzen bisher sowohl bei sicherheitsrelevanter Forschung als auch in der Förderung füher Forschungsphasen nach wie vor große Limitationen.
Deep-Tech-Innovationen adressieren sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Bundesregierung sollte ressortübergreifend das Innovationsprinzip in §44 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) verankern, sodass bei der Gesetzesfolgenabschätzung nicht nur Risiken, sondern auch Chancen für Innovation systematisch berücksichtigt werden. Daneben sollten auch öffentliche Vergabemaßnahmen für innovative Deep-Tech-Start-ups, insbesondere bei Beschaffungen im Bereich von Verteidigung und Sicherheit, nicht als Risiko, sondern als Chance verstanden werden. Zeitgleich zu einer solchen Novellierung sollte daher auch eine Reform des Vergaberechts angestoßen werden, um regulatorische Hürden abzubauen und mehr Flexibilität bei öffentlichen Fördermaßnahmen zu schaffen. Öffentliche Aufträge sollten dazu verstärkt an innovative Start-ups beziehungsweise doppelt ausgeschrieben oder durch Innovationsquoten vergeben werden, um Innovationen im und durch den öffentlichen Sektor zu fördern.
DIE AUTOREN