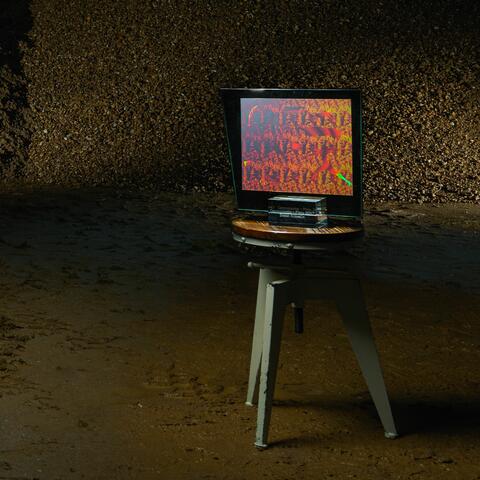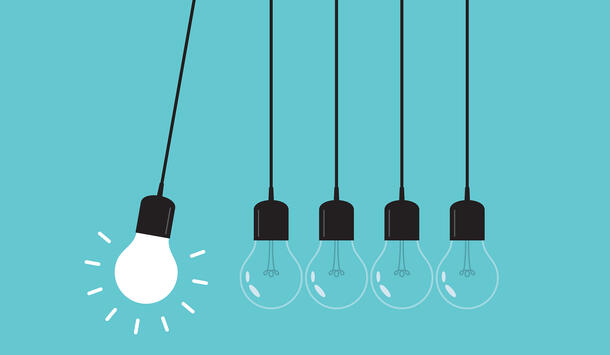Sein Jagdfieber erwacht auf der Auffahrt zur Autobahn. Stefan Kröpelin sitzt auf dem Fahrerplatz, ein paar Meter vor ihm fährt der weiße Unimog, mit dem er vor fast vier Jahrzehnten seine ersten Expeditionen in die Sahara unternommen hatte. Eine Sonderanfertigung ist es mit Bagger auf der Ladefläche und einem Getriebe, das den schweren Wagen auch durch das unwegsamste Gelände bugsiert. Die Sonne taucht den Unimog in ein unwirkliches Licht und Stefan Kröpelin braucht zwei Sekunden, um seine kleine Kamera schussbereit zu haben. „Die habe ich immer in der Tasche“, sagt er und macht einige Fotos, während er ungerührt weiterredet – eine Gewohnheit, die der Wüstenforscher von seinen Expeditionen mitgebracht hat.
Wissenschaftskommunikation
Die Wüste lebt

Und das ist nicht die einzige Schwierigkeit, die in der Wüste lauert: Die gewaltigen Sicheldünen verzeihen keine Fahrfehler. „Sie haben auf der Leeseite einen Schüttungswinkel von 34 Grad“, sagt Kröpelin, „darüber rutscht der Sand herunter.“ Aber diese 34 Grad gilt es richtig zu nehmen, nämlich frontal – schneidet ein Fahrer sie schräg an, kippt der Geländewagen auf die Seite und überschlägt sich. Die Konvois, mit denen Stefan Kröpelin in der Sahara unterwegs war, umfassten etliche Autos: erst ein paar Geländewagen, dann den Baggerunimog, schließlich einen Lastwagen („ein Dreiachser mit Doppelbereifung“). Alles, was man auf der Expedition braucht, selbst wenn sie mehrere Monate lang dauert, müssen die Fahrzeuge laden: 7.000 Liter Diesel, 3.000 Liter Wasser, die Nahrungsvorräte, dazu das ganze Expeditionsgerät. Viele Tagesreisen entfernt von der nächsten menschlichen Siedlung schlagen Kröpelin und seine Kollegen dann ihr Lager auf – in Regionen der Sahara, die zu den lebensfeindlichsten Gebieten der Erde zählen. So trocken ist es dort, dass keine Ameisen, keine Skorpione, nicht einmal Bakterien es aushalten. „Die Rallye Dakar, von der immer alle so schwärmen“, sagt Stefan Kröpelin und schüttelt den Kopf, „das ist kein Kunststück. Richtig schwierig wird so eine Wüstendurchquerung erst ohne Begleitpulk, mit extrem überladenen Fahrzeugen, die noch dazu hoffnungslos untermotorisiert sind.“
„Manchmal bin ich im Stockdunkeln die ganze Nacht umhergeirrt, es war eiskalt und ich hatte schon fast mit dem Leben abgeschlossen. “

Die Wüste kennt keine Geheimnisse
Stefan Kröpelin, der Ethnologe: „Die Wüste“, sagt er, „kennt keine Geheimnisse.“ Wenn er wochenlang mit Kamelen und Einheimischen unterwegs ist, wird ein eingeschworenes Team aus der Truppe, aus den europäischen Forschern und den einheimischen Nomaden, die oft keinerlei Schulbildung haben. Kröpelin taucht in ihren Alltag ein, in ihre Gewohnheiten, er lernt ihre Anschauungen kennen – nicht wie es bei Studienobjekten der Fall wäre, sondern einfach als Mitreisender. „Manche wären bereit, für mich ihr Leben zu riskieren, und umgekehrt ist es genauso.“ Im Tschad ist er so bekannt wie ein bunter Hund: Die Einheimischen erkennen ihn, er tritt regelmäßig im Fernsehen auf, er hat Termine mit dem Präsidenten. Und er hat mit dazu beigetragen, dass die Ounianga-Seen und das Ennedi-Massiv in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurden – je mehr er über seine Forschungen erzählt hat, so seine Erkenntnis, desto mehr konnte er bewegen.
Stefan Kröpelin, der Automechaniker: „Natürlich sollte bei jeder längeren Expedition ein Mechaniker dabei sein“, sagt er. Aber viele Probleme kann er selbst beheben, zum Beispiel platte Reifen („manchmal mussten auf einer einzigen Expedition 30 Schläuche geflickt werden“). Gelernt hat er es schon auf seiner ersten Reise 1970 mit einem schrottreifen VW-Bus von München nach Kathmandu: in Teheran einen verklemmten Kolben reparieren, wozu der ganze Motor zerlegt werden musste; in Indien das ständig auslaufende Getriebeöl abdichten; auf der Rückfahrt in Afghanistan einen gebrochenen Drehfederstab ersetzen; nur dank eines provisorisch eingebauten Axtstiels schaffte er es überhaupt erst bis zum Basar in Herat; in der Osttürkei noch eine kaputte Kupplungsscheibe austauschen und einige Pannen mehr. „Einheimische Mechaniker sind mir am liebsten: Die können mit Akazienholz, einer Blechdose und ein bisschen Draht schon viel wieder hinkriegen!“
Stefan Kröpelin, der Dokumentarfilmer: An etlichen Dokumentationen über zuvor nie gezeigte Wüstengebiete hat er mitgewirkt, einige Male begleiteten Filmteams seine Expeditionen. Beeindruckende Filme sind dabei entstanden, die zur besten Sendezeit und in vielen Ländern liefen.
Stefan Kröpelin, der Spirituelle: „Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass drei der Weltreligionen in Wüsten entstanden sind?“, fragt er. Warum? Für ihn ist die Sache klar: Die absolute Reizarmut, wo kein Geräusch, keine Ablenkung auf den Menschen eindringt und wo der endlose Sternenhimmel nachts so hell und klar leuchtet wie von einem Raumschiff aus – das sei die beste Umgebung für Kontemplation. Und dafür, um zu erfahren, wie klein, wie nichtig man als Mensch sei in dieser Welt und doch so einmalig.
„Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass drei der Weltreligionen in Wüsten entstanden sind?“

Stefan Kröpelin, der Wissenschaftler: „Bei öffentlichen Vorträgen interessieren sich viele vor allem für die Expeditionen und Abenteuer“, sagt er, „und erst am Schluss kommen fachliche Fragen zu unserer Forschung.“ Er sagt es achselzuckend, hat sich längst daran gewöhnt, dass die Umstände der Geländeforschungen oft spektakulärer wirken als die Ergebnisse selbst. Dabei haben die es in sich: Sie erzählen die abwechslungsreiche Geschichte des Klima- und Landschaftswandels und der prähistorischen Besiedlung in der Sahara, die so groß ist wie die USA und ein Drittel des afrikanischen Kontinents ausmacht.
„Erste Hinweise auf Wüstenverhältnisse reichen etwa 2,5 Millionen Jahre zurück“, sagt Stefan Kröpelin. Seitdem verlief der Klimawandel in der Sahara anscheinend in relativ gleichförmigen Zyklen von rund 100.000 Jahren: Nach jeweils etwa 90.000 Jahren extremer Trockenheit – während der Kaltzeiten – wurde es während der interglazialen Warmzeiten für etwa 10.000 Jahre feuchter. Nur in solchen „grünen“ Phasen kann der Mensch den Weg vom subsaharischen Afrika nach Europa geschafft haben – in den dominierenden Trockenzeiten bildete die Sahara eine unüberwindbare Barriere. „Unser Weg nach Europa“ heißt der Sonderforschungsbereich an der Universität Köln, wo Stefan Kröpelin genau dieser Frage nach den prähistorischen Korridoren durch die Sahara nachgeht; er untersucht dafür vor allem die letzten beiden Feuchtzeiten bis 130.000 Jahre zurück in die mittlere Steinzeit. Derzeit steht die Sahara eigentlich am Anfang einer langen Trockenperiode, die noch zehntausende Jahre weiter anhalten müsste, wenn es beim bisherigen Verlaufsschema bleibt. Ändern könnte sich das ausgerechnet dank des rezenten Klimawandels: Erhitzt sich die Erde tatsächlich immer stärker und erwärmen sich die Ozeane, sollten die Monsunwinde zunehmen und Regenwolken wieder weit in die Sahara tragen, vermutet Stefan Kröpelin. So könnte wie nach der letzten Eiszeit der altweltliche Wüstengürtel wieder ergrünen vom Atlantik bis nach Zentralasien – und so eine gigantische Kohlenstoffsenke bilden, die bislang niemand im Blick hat.
Geht er eigentlich in die Wüste, weil er dort seine geologische Forschung am besten voranbringen kann? Oder ist er Geologe geworden, um möglichst oft in die Sahara zu kommen?
Stefan Kröpelin antwortet nicht. Er vergräbt die Hände in den Taschen seiner Expeditionshose, auf der ein Fleck von Motorenöl zu sehen ist und ein kleines Loch, das er sich irgendwo an einem Felsen gerissen haben muss, und lächelt einfach nur.
Über diese Serie
20 Jahre Communicator-Preis - Grund genug für MERTON, die bisherigen 20 Preisträger in einer besonderen Bild- und Artikelserie zu würdigen. Nicht nur der Fotograf Christian Bohnenkamp setzt die Protagonisten in stimmungsvolles Licht, auch der Autor Kilian Kirchgeßner bringt sie in seinen Texten zum Leuchten. Wer die ausdrucksstarke Bilder einmal aus der Nähe sehen will: Das Wissenschaftszentrum Bonn präsentiert die Werke voraussichtich im Sommer 2021 in einer kleinen Retrospektive.