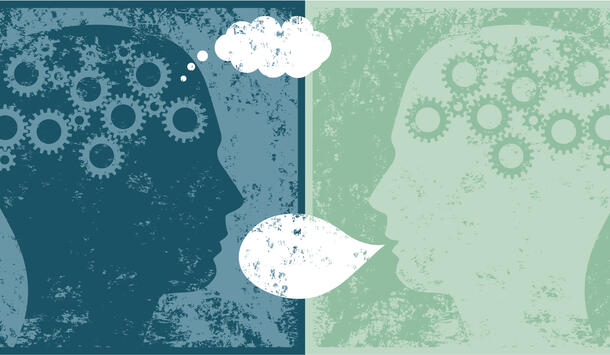Fin Bandholz freut sich auf sein Berufsleben: Nach der Masterarbeit wartet das Referendariat auf ihn, dann die Arbeit als Lehrer für Englisch und Spanisch an einer Gemeinschaftsschule oder an einem Gymnasium. Vermutlich irgendwo in Schleswig-Holstein. Dass er gerne als Lehrer arbeiten möchte, stand für den heute 26-Jährigen recht schnell fest. Weshalb der gebürtige Dithmarscher sich nach dem Abitur für ein Lehramtsstudium an der Uni Kiel entschied. Er sagt aber auch: „Ich blicke heute vollkommen anders auf meine künftige Rolle als Lehrer als noch während meines Bachelorstudiums“, und fügt hinzu: „Ich war zu Beginn meines Studiums wesentlich leistungsorientierter hinsichtlich meiner Fachinhalte und wie ich die meinen Schülern am effektivsten vermitteln kann. Mit Themen wie Vielfalt und Toleranz im Unterricht, zum Beispiel, habe ich mich nur am Rande beschäftigt.“ Doch jetzt, kurz vor dem Abschluss, habe er ein neues Verständnis für den Lehrerberuf entwickelt: „Ich bin mir meiner Rolle als Lernbegleiter sehr bewusst. Und ich trete meinen Schülern gegenüber ganz anders auf.“
Lehrermangel
Neue Wege in der Lehrerausbildung

Mehr Unterrichtserfahrung
Diesen Blick auf seinen künftigen Beruf verdankt Fin Bandholz dem Projekt SprachFoLL, das an der Universität zu Kiel vom Zentrum für Lehrerbildung und dem Germanistischen Seminar durchgeführt wurde. Die Abkürzung steht für „Sprachliche Bildung – Forschendes Lernen. Qualifizierung von Lehramtsstudierenden für die erfolgreiche Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen“ und ist eine Zusatzqualifikation für Lehramts-Masterstudierende jeden Faches. Die Qualifikation verhalf Bandholz zu Unterrichtserfahrungen an einer Projektpartnerschule – mit Schülern, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen und nun in Vorbereitungsklassen zunächst einmal Deutsch lernen und sich grundsätzlich im Alltag ihrer neuen Heimat zurechtfinden müssen.
Bandholz unterstützte zwei Semester lang jede Woche drei Schulstunden die Lehrkraft in einer dieser Deutsch-als-Zweitsprache-Klassen. „Normalerweise werden Lehramtsstudierende auf diese Situation praktisch nicht vorbereitet und sind oft überfordert, wenn sie das erste Mal vor einer Gruppe von jungen Nichtmuttersprachlern im Fachunterricht stehen“, beschreibt der künftige Lehrer die Situation. „Es wäre sehr sinnvoll, dass jeder Studierende zusätzlich zu seinen beiden Unterrichtsfächern auch Erfahrungen in Deutsch als Zweitsprache sammeln muss.“ Doch das ist an den meisten Hochschulen nicht vorgesehen.
„Es wäre sehr sinnvoll, dass jeder Studierende zusätzlich zu seinen beiden Unterrichtsfächern auch Erfahrungen in Deutsch als Zweitsprache sammeln muss.“

Stark durch Diversität
2018 haben Stifterverband und die Schöpflin Stiftung, gefördert durch die Stiftung Mercator, das Netzwerk „Stark durch Diversität – Förderung interkultureller Kompetenzen in der Lehramtsausbildung“ ins Leben gerufen. Darin kommen regelmäßig zehn Hochschulen zusammen, die zuvor im Wettbewerb „Spracherwerb stärken“ des Sonderprogramms „Integration durch Bildung“ ausgezeichnet wurden. Das Ziel: Sich gemeinsam mit weiteren Projekten und Institutionen über Best-Practise-Projekte und den Stellenwert von interkulturellen Kompetenzen in der Lehrerbildung auszutauschen.
2019 erschein zum Abschluss des Netzwerks die Handreichung „Lehrkräftebildung für die Schule der Vielfalt“. Die Publikation kann hier heruntergeladen werden.
 image](/sites/default/files/styles/780x440/public/photocasewemxqzh956356552_marqs_16_9.jpg?itok=dIUhNmVh)