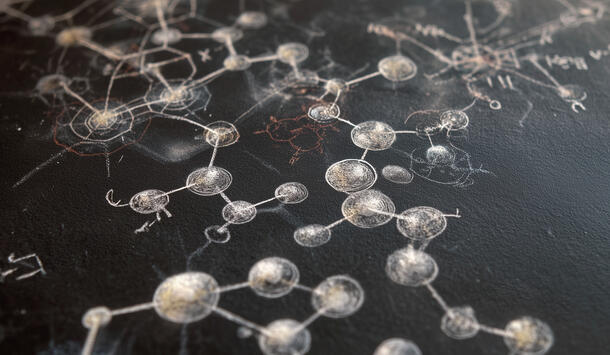Die Forschungsergebnisse am Institut für Chemie der Technischen Universität Berlin können sich sehen lassen: Mehr als 40 Patente wurden hier angemeldet. Manche bieten Lösungen für aktuelle ökologische Herausforderungen. Zum Beispiel ein Katalysator, der, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt und mit Sonnenlicht bestrahlt wird, unerwünschte Stoffe wie Arzneimittelrückstände oder Mikroplastik vernichtet. Sie werden gasförmig und zurück bleibt sauberes Wasser. Doch aus keinem dieser Patente ist bisher ein Produkt geworden. Ein Unding, findet Martin Rahmel: „Wir haben nicht den Luxus, mit Steuergeldern finanzierte Forschungsergebnisse in der Schublade versauern zu lassen. Wir brauchen Anwendungen, die unseren Planeten entlasten“, sagt der Leiter der Chemical Invention Factory an der TU Berlin.
Er selbst hat sich vor neun Jahren aus dem Chemie-Exzellenzcluster „UniCat“ der Universität heraus an der Gründung eines Unternehmens beteiligt. Vor zwei Jahren kam er zurück an die Hochschule, „um der nächsten Generation zu zeigen, wie man das macht“. Dabei kämpft er vor allem für eine andere Mentalität in seinem Fachbereich: Eine Umfrage unter den Studierenden der Hochschule ergab, dass sich in der Chemie gerade einmal 19 Prozent vorstellen können, ein Unternehmen zu gründen – das ist der geringste Wert unter den elf befragten naturwissenschaftlich-technischen Fachbereichen. In der Informatik zum Beispiel waren es 61 Prozent. „Aber mit Computern allein werden wir den Planeten nicht retten“, sagt Rahmel. Mit den zwölf Prinzipien der „Green Chemistry“, die unter anderem die Abkehr von einer fossilen und die Hinwendung zu einer nachwachsenden Rohstoffbasis verfolgt, hingegen schon.
Future Skills
Schlummerndes Potenzial

Es ist das Ziel des Programms, die Entrepreneurial Skills interdisziplinär in der akademischen Ausbildung zu verankern. Hochschulen mit dieser Stoßrichtung konnten sich im Jahr 2020 für eine Förderung bewerben. 69 Anträge aus 15 Bundesländern gingen ein, 16 davon wurden zur ersten Förderphase ausgewählt. „Zu dem Thema gibt es keine Lösung nach dem Muster ‚One size fits it all‘“, sagt Johanna Ebeling, die das Programm beim Stifterverband verantwortet. Die Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer hätten alle ihre individuellen Bedarfe ermittelt und entsprechende Lösungsvorschläge unterbreitet. Diese konnten sie dann über einen Zeitraum von rund einem Jahr in gemeinsamen Curriculumswerkstätten weiter ausfeilen. „Die Heterogenität der Konzepte zeigte, dass sich die Hochschulen auf unterschiedliche Weise mit den Herausforderungen beschäftigen und den Qualifikationsbedarf erkannt haben“, sagt Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.
„Wir haben nicht den Luxus, mit Steuergeldern finanzierte Forschungsergebnisse in der Schublade versauern zu lassen.“

Zweite Förderrunde gestartet
Im Dezember 2021 entschied sich dann, welche Hochschulen mit ihren Konzepten die Wettbewerbsjury überzeugen und sich für eine zweite Förderphase qualifizieren konnten. „Ein wichtiges Kriterium dabei war: Hat das Projekt Impact? Hat es das Potenzial, die Innovationskraft Deutschlands zu stärken?“, sagt Hermann Rothert, Jurymitglied und Head of Sustainability AS AN ORGANIZATION bei der Allianz. Die TU Berlin und die Hochschule München konnten überzeugen. Ebenso die Hochschule Ansbach, die Universität Göttingen und Ruhr-Universität Bochum. Die letzten beiden entwickelten einen ähnlichen Zugang über den Weg des Challenge-based Learnings und wurden deshalb als Projektteam gefördert. Die ausgezeichneten Hochschulen erhielten je 175.000 Euro beziehungsweise 250.000 Euro für das Konsortium, um ihre Pläne bis Ende 2024 in die Tat umzusetzen.
Die 5 ausgewählten Hochschulen
Für ihre drei Fakultäten Wirtschaft, Medien und Technik hat die Hochschule zwei Angebote entwickelt: das Modul „How to start up“, das sich an Gründungswillige mit einer konkreten Idee richtet, und ein Zertifikat Entrepreneurship, mit dem Studierende in drei Modulen in das Thema hineinschnuppern können. Wegen der großen Nachfrage ist es Ziel der zweiten Förderphase, die Zugänglichkeit des Angebots zu erhöhen. Wer das Modul absolviert, soll eine Coaching-Ausbildung erhalten, sodass die Personen als Mentorinnen beziehungsweise Mentoren ihre Kenntnisse an andere Interessierte weitergeben können. Geplant ist außerdem ein Anreizsystem für Professorinnen und Professoren, unternehmerische Inhalte stärker in ihre Lehre zu integrieren.
Mit dem Strascheg Center for Entrepreneurship hat die Hochschule bereits eine Anlaufstelle für zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer. Neues Ziel ist es, bereits Erstsemester mit dieser Institution in Kontakt zu bringen und entsprechende Denkansätze anzustoßen. Zum Wintersemester nahmen deshalb 100 Studierende am Piloten für eine Einführungsveranstaltung teil. Direkt zum Auftakt ihres Studiums sollten sie sich zwei Tage lang eine eigene Challenge zum Thema Nachhaltigkeit suchen und dazu ein Geschäftsmodell entwickeln. Dieses noch freiwillige Angebot soll langfristig als Pflichtveranstaltung für Erstsemester aller 14 Fakultäten verankert werden.
Gleich zwei Hochschulen setzten in ihrer Bewerbung für das Programm auf Challenge-based Learning, das Lösen von konkreten Aufgaben aus der Praxis, als ihren Weg zur Vermittlung von Entrepreneurial Skills. In der ersten Förderphase kamen sie überein, dass sie mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zum Thema voneinander lernen können, und werden deshalb nun als Projektteam gefördert. In Göttingen geht man den Weg, das schon bestehende Modul „Entrepreneurship and Innovation“ an möglichst vielen Fakultäten zu etablieren. An der Ruhr-Universität sollen unternehmerische Denkansätze in Wahlpflicht-Modulen mit interdisziplinären Inhalten verankert werden.
An der Technischen Universität Berlin ist die akademische Ausbildung von Unternehmerinnen und Unternehmern mit dem Fachgebiet „Entrepreneurship und Innovation Management“ bereits gut etabliert. Aber sie erreicht zu selten die Fachgebiete, die mit ihrem Forschungsoutput ein großes Potenzial für Innovationen haben, wie zum Beispiel die Chemie. Die Hochschule nutzt die Förderung im Programm, um spezielle Module für Studierende im Fachbereich Chemie zu entwickeln, die sie mit fachspezifischen Prototypen, Case Studies, Industriekontakten und Start-ups an das Thema Unternehmertum heranführen. Dieser Ansatz ließe sich bei Bedarf auch auf andere Fachgebiete übertragen.
Wer sich wirklich für eine Gründung entscheidet, das hängt am Ende nicht nur von äußeren Impulsen, sondern auch von Persönlichkeitsmerkmalen ab. Aber selbst diejenigen, die als ihren Weg eine Anstellung wählen, profitieren. „Die Bereitschaft, Risiken einzugehen – das ist zum Beispiel auch eine wertvolle Eigenschaft für ein erfolgreiches Projektmanagement“, erklärt Johanna Ebeling. So betrachtet lässt sich tatsächlich die Bedeutung der Entrepreneurial Skills für alle Fachbereiche rechtfertigen.
Denn innerhalb eines Unternehmens entfalten Entrepreneurial Skills auch als sogenannte Intrapreneurial Skills der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Wirkung: „Der Angestellte, der seine Aufgaben zugeteilt bekommt und sie abarbeitet – das ist ein Bild aus der Vergangenheit“, sagt Hermann Rothert. Stattdessen werde heute von Beschäftigten ein gewisses Maß an unternehmerischem und innovationsoffenem Denken erwartet. Viele Großunternehmen haben Innovationsabteilungen oder schicken ihre Belegschaft zu Design-Thinking-Schulungen. Denn jede kleine Innovation bringt in der Summe ein Unternehmen voran und steigert seine Wettbewerbsfähigkeit. „Und wer könnte besser beurteilen, mit welchen Veränderungen er seinen Arbeitsbereich optimieren kann, als der einzelne Mitarbeiter?“ Verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen unternehmerischen Blick und die Fähigkeit, ein Geschäftsmodell anzupassen und zu verbessern, sind sie für den Arbeitgeber viel wert. Je mehr die Hochschulen ihren Studierenden Entrepreneurial Skills mit auf den Weg geben, desto mehr tun sie also für die berufliche Zukunft ihrer Absolventinnen und Absolventen.