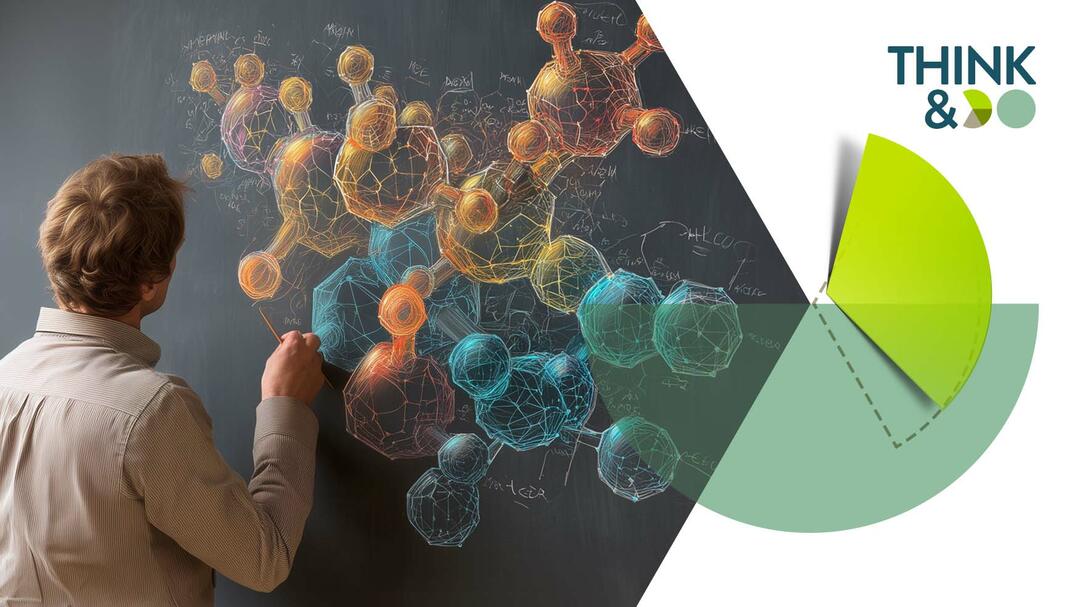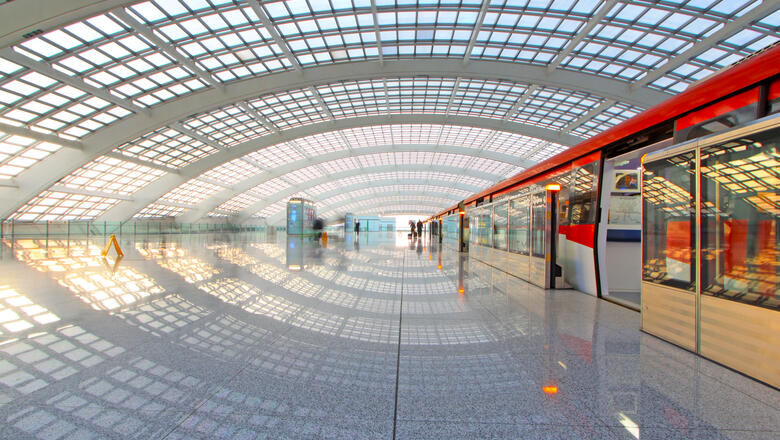(Hinweis der Redaktion: Das Transkript wurde automatisiert erzeugt und nicht nachträglich gegengelesen. Es kann also Fehler enthalten. Im Zweifel gilt das gesprochene Wort in der Sendung.)
Wenn man sich bedenkt, an wie vielen Stellen uns zukünftig die Quantenphysik begegnen wird, wäre es einfach eine unglaubliche Frechheit aus meiner Perspektive, wenn lediglich die Gymnasialschüler davon etwas verstehen würden. Das würde auch zu einer gewissen weiteren Spaltung führen, dass man also den Oberschülern aus schulischer Perspektive da also gar nichts dazu sagt. Wenn man jetzt in der Öffentlichkeit über Quantenphysik spricht, wird es oft mystifiziert. Es ist bizarr, es ist unverständlich. Und wir müssen von dieser Mystifizierung der Quantenphysik weg. Man soll pragmatisch mit den quantenphysikalischen Gesetzen umgehen, zeigen, was unterschiedlich ist von der klassischen Physik. Also ich finde, das sehr analytische und logische Denken, das liegt mir jetzt mehr als zum Beispiel Englisch Leistungskurs.
Und es ist auch so, dass man in der Physik das eigentlich relativ gut versteht, weil man sich alles logisch herleiten kann. Und dadurch treten dann auch keine Verständnisprobleme auf oder irgendwas ist unklar, sondern man kann das halt immer gut beweisen, gut nachweisen. Die Quantentechnologie finde ich wirklich unglaublich interessant, muss ich sagen, weil das einfach so ein Bereich der Physik ist, der noch nicht so ausgereift ist, sag ich mal, wie die aktuellen physikalischen Kenntnisse, was zum Beispiel Optik und alles um Elektronik und sowas angeht. Und ich finde es einfach unglaublich interessant, wie es damit weitergehen kann, was die Möglichkeiten der Zukunft sind. Ich finde es unglaublich spannend, wie es jetzt in Zukunft im Quantencomputer funktionieren kann. Schrödingers Katze ist eine gute Veranschaulichung, wie absurd eigentlich die Quantenwelt ist und wie diese Überlagerungszustände so stattfinden oder wie komisch die eigentlich sind, dass sie sich mit unserer makroskopischen Welt eigentlich gar nicht vereinbar sind. Die neue Welt der Quanten und Quantentechnologien fasziniert.
Diese Welt kann aber ebenso schnell verwirren. Junge Menschen genauso wie Erwachsene. Und damit herzlich willkommen beim Podcast des Stifterverbandes Think and Do. Mein Name ist Corina Niebuhr und ich darf euch durch diese Folge begleiten. Diesmal geht um die Quantenskills, also die Fähigkeiten mit den neuen Quantenphänomenen und Quantentechnologien umgehen zu können. Es geht ja auch um gesellschaftliche Teilhabe. Es geht darum, von so technologischen Entwicklungen nicht überrascht zu werden.
Wenn man einfach mitbekommt, was technologisch möglich ist, dass man nicht denkt, dass das irgendwie Magie, dass Ängste abgebaut werden oder dass auch bestimmte Vorbehalte nicht erst entstehen, aber auch, dass man es irgendwie einschätzen kann, ein Stück weit. Das sagt Andreas Land. Er leitet im Stifterverband das Programm Quantum skills. Dieses Programm soll Bildungsangebote rund um die Quantentechnologien voranbringen. Denn weitaus mehr Menschen als bislang sollten wissen, wie man damit umgeht. Auch schon Schülerinnen und Schüler. Gesche Pospiech erklärt, warum.
Sie ist Professorin an der TU Dresden in der Fakultät Physik. Dann möchte man die Schüler vorbereiten auf das Leben in der Gesellschaft. Das heißt, sie sollen imstande sein, am gesellschaftlichen Diskurs zum Beispiel über Quantentechnologien teilzunehmen. Und dazu brauchen sie natürlich einige Grundlagen zu den Quantentechnologien, damit sie ungefähr wissen, wie so etwas wie ein Quantencomputer funktioniert, wie Quantenkryptografie funktioniert. Da sollen sie zumindest einen kleinen Einblick haben. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen lernen, Medienberichte, YouTube-Videos, Internetblogs zu beurteilen, zu verstehen, zu schauen, ist das plausibel, was dort über Quantentechnologien und Quantenphysik berichtet wird. Ist es nicht plausibel?
Und auf diese Art und Weise kommunikations- und beurteilungsfähig sind im Bereich der modernen Quantentechnologien. Immerhin werden die Quantentechnologien in den kommenden Jahren vieles stark verändern. Zum Beispiel, wie unsere Computer und Sensoren funktionieren. Oder auch, wie wir Daten verschlüsseln und schützen. Franziska Greinert ist an der TU Braunschweig wissenschaftliche Mitarbeiterin für Physikdidaktik. Wir hören sie hier bei ihrem Vortrag auf dem diesjährigen University Future Festival, das der Stifterverband mitträgt. Franziska Greinert erklärt, wie Quantensensoren in Zukunft eingesetzt werden können.
Damit werden dann potenziell Gravitation und Magnetfelder deutlich sensitiver messbar. Das auch im Bereich der medizinischen Bildgebung, um Gehirnströme genauer messen zu können. Und im Gegensatz zu Quantencomputern, wo keiner so genau weiß, wie lange wird es noch dauern, bis wir dann mal wirklich einen praktischen Nutzen sehen, sind Quantensensoren schon deutlich weiter in der industriellen Readiness. Die sind schon an der Schwelle zur Marktreife. Erste Unternehmen, die Quantensensoren auch in dem medizinischen Bereich bereitstellen. Einige Quantentechnologien kommen also schneller in die Anwendung, als viele denken. Es herrscht Aufbruchsstimmung.
Hinzu kommt, Deutschland könnte bei den Quantentechnologien weltweit ganz vorne mitspielen. Das fand die Expertenkommission Forschung Innovation heraus, kurz EFI. Sie berät die Bundesregierung. Die Voraussetzungen jedenfalls seien sehr gut, berichtet die EFI. Wenn da nicht diese eine Hürde wäre. Andreas Land vom Stifterverband. Von unserem Mitgliedsunternehmen haben wir ganz klar die Dringlichkeit mitgenommen, dass es jetzt schon schwer ist, Fachkräfte zu bekommen.
Und auch, dass es nicht nur darum geht, hochqualifizierte Entwickler zu bekommen oder Entwicklerinnen zu bekommen. Es braucht in allen möglichen Bereichen Fachkräfte, die die neuen Quantentechnologien zumindest halbwegs verstehen und einschätzen können. In der Produktentwicklung, im Management, im Marketing, genauso wie im Vertrieb. Wie die Berufsbilder konkret aussehen werden, ist jetzt teilweise noch gar nicht klar. Aber, dass sie einen Bezug haben werden zur Quantentechnologie, das kann man schon ziemlich deutlich absehen. Deutschland braucht Quantum Skills. Dafür setzt sich der Stifterverband mit seinen Partnern seit Jahren ein.
Denn es reicht bei Weitem nicht aus, diese Technologien zu erfinden und zu entwickeln. Die innovative Kraft in diesen Feldern kann sich nur entwickeln, wenn auch genügend gut ausgebildete Fachkräfte da sind. Und dafür müssen Quantentechnologien schon in der Schule eine Rolle spielen. Es wird unglaublich viel investiert im Moment in Quantentechnologien weltweit. Da geht ganz, ganz viel Geld rein. Und wenn man halt in der Gesellschaft mitdiskutieren möchte und wenn man politisch partizipieren möchte und entscheiden will, was ist gefährlich, was ist vielleicht unglaublich wichtig für die Gesellschaft, für den Staat, dann muss man natürlich als Mitglied der Gesellschaft wissen, was die Grundlagen sind. Und deshalb gehört es eigentlich in Schule für die demokratische Beteiligung und für den gesellschaftlichen Rückhalt auch der Quantentechnologien, dass die auch weiter gefördert werden können.
Das sagt Jörg Gutschank. Er ist Physik-, Mathe- und Informatiklehrer am internationalen Leibniz-Gymnasium in Dortmund. Jörg Gutschank zählt zu einem kleinen Kreis von Lehrkräften, die bereits Wissen über die Quantentechnologien in ihren Unterricht einfließen lassen. Das passiert bislang hauptsächlich an Gymnasien. Paul Nachtigall findet das ungerecht. Er unterrichtet Physik am Gymnasium Cosweg in Sachsen. Aus seiner Sicht ist es eine Frage der Chancengerechtigkeit, dass der Quantentechnologieunterricht zum Beispiel auch an der Realschule stattfindet.
Von daher denke ich, dass es auch notwendig wäre, dass nach und nach zumindest gewisse Grundlagen auch in die Klassenstufe 10 zu integrieren. Und durch die Klassenstufe 10 wäre es zumindest auch in der Realschule oder Realschulabschluss schrägstrich Oberschule möglich, wenigstens ein paar Grundlagen zu vermitteln. Und die Schüler, die sich halt eben dafür interessieren, auch an einer Oberschule, die können sich dann dementsprechend in der heutigen Zeit sehr leicht damit weiter beschäftigen. Dass Schulen Quantum Skills möglichst flächendeckend ausbilden, das möchte der Stifterverband voranbringen und sieht hierfür die Lehrkräftebildung als eine zentrale Stellschraube. Und genau die steht vor Herausforderungen. Wie Gesche Pospiech berichtet, die Didaktikerin. Es ist aber ein grundsätzliches Problem der Lehramtsausbildung, dass die fachliche Ausbildung sich nicht ohne weiteres auf Schulniveau herunterbrechen lässt.
Und das ist in der Quantenphysik vielleicht besonders ausgeprägt. Insofern steht da für die Fachdidaktik auch noch viele Aufgaben bevor. Wie kann man die Lehrkräfte dabei unterstützen? Durch zur Verfügung stellen von Materialien, Materialien aller Art, Videos, Unterrichtskonzepte, Arbeitsblätter, Experimente, damit sie die Inhalte auch umsetzen können. Der Stifterverband geht große Aufgaben kooperativ und partizipativ an. Auch im Programm Quantum Skills Genaueres beschreibt Andreas Land. Das ist natürlich schon auch ein spezielles Thema, Quantenphysik, Quanteninformatik, sodass wir da jetzt gar nicht konkret wussten, was jetzt die dringendsten Punkte sind.
Deswegen haben wir eine Expertengruppe zusammengerufen, die im, wie wir es dann nannten, Curriculum Labs, die wichtigsten Stellschrauben identifizieren sollte, um die Lehrkräftebildung voranzubringen. Es ging dann um politische Rahmenbedingungen, aber auch zur Gestaltung von Studiengängen. Vieles können Hochschulen selber angehen in der Gestaltung der Studiengänge. Das können auch Hochschullehrende alleine angehen. Manches braucht aber auch die politische Akteure, die dann handeln müssen und die Rahmenbedingungen eben anpassen müssen. Vor welchen Herausforderungen stehen die Lehrkräfte überhaupt im Puncto Quantum Skills Hier gibt uns Jörg Gutschank Einblicke, Physik-, Mathe- und Informatiklehrer aus Dortmund. Es ist natürlich eine schwierige Aufgabe, weil die Lehrpläne das noch nicht so ganz explizit immer benennen, was man da an Quantentechnologien machen soll.
Auch die Lehrkräfte sind ja eigentlich gar nicht dafür ausgebildet. Ich habe da jetzt den Vorteil, dass ich ein Seiteneinsteiger bin und an einem Physiklehrstuhl promoviert habe, wo andere Leute Quantencomputing gemacht haben, sodass ich da einen gewissen Hintergrund habe. Also das ist eine Stelle, wo die Seiteneinsteiger ganz viele Vorteile haben gegenüber denen, die eine normale Lehrerausbildung gemacht haben. Aber was halt auch eine große Hürde ist, ist die Unterteilung in Fächer an der Schule. Also eine Schule schmeißt ja immer die Schüler in einzelne Schubladen, je nach Unterrichtsstunde in verschiedene Fächer. Und Quantentechnologieanwendungen, die werden halt interdisziplinär entwickelt und nicht in einem Fach. Wenn ich jetzt einem Physiklehrer sage, dass er Quantenalgorithmen unterrichten soll, dann wird da jeder Physiklehrer sagen, warum verschwende ich meine Zeit im Physikunterricht damit?
Das gehört doch in den Informatikunterricht. Das sind die großen Hürden. Jörg Gutschank brachte seine Expertise in die Curriculum Labs beim Stifterverband ein. Mit weiteren 16 interdisziplinären Expertinnen und Experten für Quantenphysik, Quanteninformatik und ihre jeweilige Didaktik erarbeitete die Gruppe das Diskussionspapier Quantum Skills in der Lehrkräftebildung. Das war eine fantastische Gruppe. Also es war sehr schön, weil es war von gestandenen älteren Professuren bis über den Ruhestand bis hin zu jungen Doktoranden ist die Gruppe sehr breit aufgestellt gewesen, von den Fachwissenschaften auch. Heißt also aus den verschiedenen Bereichen des MINT, also nicht nur Physiker, nicht nur Informatiker.
Und dieses breite Denken hat natürlich uns, denke ich, enorm vorangebracht, wirklich die Aspekte umfassend zu berücksichtigen, wie man hier etwas erreichen kann zukünftig. Das sagt Markus Gretzschel. Er ist Physik- und Informatiklehrer am Gymnasium Coswig in Sachsen und darüber hinaus Vorstandsmitglied des Deutschen Philologenverbandes. Damit sitzt Markus Gretzschel an der Schnittstelle zur Politik. Denn der Philologenverband hat Zugang zur Kultusministerkonferenz. Auch dort sollen die erarbeiteten Empfehlungen aus dem Positionspapier Quantum Skills in der Lehrkräftebildung ankommen. Ein Punkt ist Markus Gretschel besonders wichtig.
Wir müssen zuerst an die Lehrkräfte im System denken, weil das sind viel, viel mehr. Das war übrigens in diesem Positionspapier oder Empfehlungspapier auch so ein Kernpunkt für mich, wo ich sage, da greift unsere Fortbildung viel schneller, als wenn wir die zukünftigen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Aber die sind ja schon da und die müssen heute Quantentechnologie lehren. Die müssen erst mal ausgebildet werden. Thomas Filk gehört ebenfalls zu den Experten, die das Empfehlungspapier erarbeitet haben. Er ist Professor am Physikalischen Institut an der Universität Freiburg.
Und er stimmt Markus Gretzschel zu. Der eine Aspekt ist, dass Lehrkräfte, die schon vor, ich sag mal, 20 Jahren die Universität verlassen haben, oftmals eine Vorlesung zur Quantentheorie gehört haben, die nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entspricht. Da sind natürlich Fortbildungen wichtig für Lehrkräfte. Und dazu äußert sich ja auch das Thesenpapier, wie solche Fortbildungen aussehen könnten. Das heißt, wir müssen sicherlich Lehrkräfte, die schon seit vielen Jahren an Schulen sind und die nicht nach diesen neueren Gesichtspunkten ausgebildet wurden, noch mal fortbilden und auf diese neuen Standards bringen. Worum genau geht es bei diesen Fortbildungen? Das erklärt uns Gesche Pospiech.
Sie war bei den Curriculum Labs ebenfalls dabei und brachte ihre Expertise als Physikdidaktikerin ein. Es ist ein anderer Zugang. Es stimmt schon, früher hat man Quantenphysik sozusagen mit vielen Objekten gemacht und hat auf diese Art und Weise verstanden, wie die Körper unter uns funktionieren. Das war eine Voraussetzung für Laser, für Halbleitertechnologie. Also alles, was wir jetzt mit dem Computer machen, beruht letztendlich darauf, dass man irgendwie versteht, wie Festkörper, das heißt viele Atome und Moleküle, zusammenwirken nach den Gesetzen der Quantenphysik. Und in den modernen Quantentechnologien ist man jetzt wirklich dabei, dass man mit einzelnen Elektronen, einzelnen Photonen, einzelnen Atomen arbeitet. Das heißt wirklich ganz gezielt die Eigenschaften von einzelnen Quantenobjekten nutzen kann.
Diese Technologien haben sich seit den 90er Jahren entwickelt. Und aus dieser Grundlagenforschung mit einzelnen Quantenobjekten hat sich dann doch recht schnell und ich habe das Gefühl immer rasanter die Quantentechnologie entwickelt, die mit einzelnen Qubits, sagen wir, einzelnen Quantenobjekten arbeitet, die man natürlich auch kontrollieren muss und die dann aber dafür natürlich auch sehr viel empfindlichere, präzisere, genauere Messinstrumente zum Beispiel erlauben wird. Die erlauben wird, einen Quantencomputer zu bauen und die Gesetze der Quantenphysik erlauben eine sichere Quantenkryptographie. Und da ist es so, dass die Physik sozusagen die physikalischen Gesetze beisteuert und die Informatik würde beisteuern, welche Algorithmen braucht man, welche Protokolle für die Kryptographie. Und das erfordert von der Informatik aber auch ein Umdenken. Die klassischen Algorithmen, die man für den Standardcomputer verwendet, funktionieren nicht für den Quantencomputer. Da braucht man eigene Algorithmen und man muss algorithmisch ganz anders denken.
Und das wäre für die Informatik die Herausforderung. Eine Empfehlung aus dem Positionspapier des Stifterverbandes lautet: Lehrkräftefortbildung für einen modernen Unterricht zu Quantenphysik und Quanteninformatik sollten niedrigschwellig sein. Markus Gretzschel vom Deutschen Philologenverband hält dies für besonders wichtig. Die Lehrkräfte sind hoch belastet, gar keine Frage, haben wir in anderen Berufsgruppen genauso. Aber wenn ich ein neues Ziel hier reinbringen möchte, dann muss das Angebot für die Lehrkraft so niederschwellig wie möglich sein. Das heißt also, und hier wünsche ich mir wieder die Politik mehr im Boot, dass sie die Bedeutung erkennt und dass Projekte, die sowas fördern, dass es Lehrer niederschwellig direkt nutzen können, dass das gut verfügbar ist, leicht verfügbar ist, dass die Lehrkraft de facto das umsetzt. Ich will es an einem Beispiel aus dem Netzwerk Teilchenwelt deutlich machen.
Die haben sogenannte Masterclasses. Da kommt eben eine Doktorandin oder ein Doktorand an die Schule. Der Lehrer muss entsprechend natürlich inhaltlich mit der Materie gut betraut sein. Aber die Inhalte werden von den Mitarbeitern vom Netzwerk Teilchenwelt umgesetzt. Und das ist diese Niederschwelligkeit, die ich erwarte. Die neuen Inhalte werden direkt von jungen Menschen wieder an junge Menschen weitergetragen. Das ist der höchste Effekt, den man erzielen kann aus meiner persönlichen Sicht.
Welche Ansätze für die Lehrkräftequalifizierung gelingen besonders gut in der Praxis? Solche Ansätze möchte der Stifterverband mit seinem Programm Qubit Fellowships für die Lehrkräftebildung sichtbar machen und stärken. Er fördert hierfür fünf Fellowships. Ein Fellowship erhielt Thomas Filk von der Universität Freiburg. Gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Woizik. Beide erarbeiten Kurztexte zu Quantentechnologien für angehende MINT-Lehrkräfte. Thomas Filk erklärt, was es damit auf sich hat.
Zum einen habe ich seit zwölf Jahren ungefähr jetzt eine Vorlesung gehalten zur Quantentheorie. Speziell für Studierende auf das Lehramt. Aus dieser Vorlesung ist zunächst ein Skript entstanden und dann irgendwann auch ein Buch. Das ist das eine Material. Das andere Material ist, dass wir derzeit sogenannte Kurztexte, also wir haben sie mal Kurztexte genannt, erstellen. Zu bestimmten Themen, die eine Schulrelevanz haben, unter anderem eben auch zu Themen der Quantentheorie. Das sind modernere Themen wie Quantenkryptografie und eben auch Quantencomputing, Quantenteleportation und solche Sachen.
Zu diesen Themen gibt es halt eben Texte, in die sich Lehrkräfte einarbeiten können, nicht nur Studierende, sondern die Texte sind frei verfügbar, auch für Lehrkräfte, die schon an den Schulen sind. Im Programm Quantum Skills kommen Personen zusammen, die zeigen, dass sich die Forderungen aus dem Thesenpapier Quantum Skills in der Lehrkräftebildung umsetzen lassen. Hören wir hierzu noch einmal Thomas Filk. Man kann diesen Stoff in einem Semester vermitteln. Insofern reden wir jetzt nicht hier über irgendwelche abstrakten Ideen, wo es dann nachher vielleicht heißt, ja das geht sowieso nicht in einem Semester oder das kriegen wir sowieso nicht alles durch. Die Tatsache, dass diese Vorlesung schon zehn, zwölf Mal gehalten wurde, heißt, man kann es in diese Richtung machen. Eine solche Vorlesung ist möglich und da sehe ich jetzt meinen wichtigsten Beitrag, die Stichpunkte, die in einer solchen Vorlesung behandelt werden, sind ja auch im Anhang dieses Thesenpapiers aufgenommen worden.
Thomas Filk kritisiert, dass an vielen Universitäten das Lehramtsstudium immer noch vernachlässigt wird. Universitäten legten immer noch den Fokus auf die Studierenden, die zum Beispiel ihren Bachelor of Science machen. Die Vorlesungen, die man normalerweise an der Universität hört, sind forschungsorientiert, das heißt, sie bilden aus, um später in der Forschung oder der Produktentwicklung arbeiten zu können. Das, was Lehrkräfte aber brauchen, sind Vorlesungen, in denen sie Inhalte so vermittelt bekommen, dass zum Beispiel eine Elementarisierung möglich ist, dass die Inhalte auch auf den Schulstoff abgestimmt sind, dass zum Beispiel auch didaktische Ansätze, die in der Schule verwendet werden, in dieser Vorlesung auch behandelt werden. Es gibt verschiedene Konzepte, das sogenannte Zeigerkonzept von Bader oder die Wesenszüge der Quantentheorie von Kübelbeck und Müller oder das Erlanger Quantenlabor und so weiter. Das sind alles Dinge, die normalerweise in einer Vorlesung zur Quantentheorie beispielsweise nicht zur Sprache kommen, aber die in einer solchen Vorlesung speziell für Lehrkräfte wirklich diskutiert werden sollten. Es gibt dann noch viele andere Dinge, die man in einer solchen Vorlesung machen sollte.
Man sollte zum Beispiel auch auf interpretatorische Fragen eingehen, also welche Art von Interpretation der Quantentheorie gibt es überhaupt? Wohin unterscheiden die sich?
Was sind die Probleme? Also wissenschaftsphilosophische Fragen. Wer sich an den Schulen mit einem anschaulichen Unterricht zu den Quantenphänomenen und Quantentechnologien vorwagt, muss sich in der Regel noch durchkämpfen und kreativ sein. Diese Realität beschreibt uns Jörg Gutschank vom Internationalen Leibniz Gymnasium in Dortmund. Ich bin jetzt hier gerade auf einer Fortbildung, wo es genau darum geht, Quantentechnologieanwendungen den Schülern zugänglich zu machen durch Experimente, die die Schulen sich auch leisten können. Vieles davon entsteht dann im 3D-Druck. Das ist natürlich dann auch wieder oft verknüpft mit einer Eigeninitiative der Lehrer, die das dann am Ende drucken müssen, nachdem sie fortgebildet wurden.
Das hat die Schule dann trotzdem noch nicht. Und es ist auch so, dass das ehrlicherweise noch sehr in den Anfängen steckt. Also es gibt da jetzt schon so einzelne Dinge. Wir können einzelne Photonen, also Lichtteilchen, die kann man in der Schule meistens nicht einzeln manipulieren. Also man nimmt meistens dann einen Laserstrahl oder so. Und das, was in Quantentechnologien aber benötigt würde, also dass einzelne Teilchen, einzelne Photonen miteinander wechselwirken, ist in der Schule noch sehr schwer abzubilden. Da also Erfahrungen für die Schüler zu erzeugen, ist nicht ganz leicht. Das Problem ist, wenn man mit echten Quanten experimentieren möchte, dann sind es so teure Experimente, dass die eigentlich nicht in jeder Schule eingesetzt werden können.
Ein selbst normales Spektrometer ist für viele Schulen, kostet dann 3.000, 4.000 Euro und ist dann für viele Schulen auch schon zu teuer. Da wäre es schön, wenn sich Forschungsinstitute oder Schülerlabore oder Hochschulen, Universitäten denn die sich noch stärker öffnen würden in Schulen und strukturiert zusammenarbeiten würden. Das schlägt Andreas Land vom Stifterverband vor. Am Gymnasium Coswig in Sachsen wird das bereits hin und wieder umgesetzt. Das berichtet uns der Physiklehrer Paul Nachtigall. Wir jetzt hier in Coswig haben den Vorteil, dass wir beispielsweise eine geringe Entfernung zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf haben. Und die Anbindung ist einigermaßen gut, sodass wir da eben auch das ein oder andere Mal das Schülerlabor direkt von dem Forschungszentrum nutzen können.
Und das ermöglicht natürlich auch nochmal das Einbinden externer Partner. Für den Unterricht an sich heißt es natürlich, dass wir auf Simulationen zurückgreifen müssen, um das Ganze einigermaßen veranschaulichen zu können. Paul Nachtigall würde solche Kooperationen sehr gerne öfter nutzen. Doch im Schulalltag ist dafür fast keine Zeit da. Es sind die Unterrichtspläne, die sich verändern müssen. Von daher würde ich mir auch da wieder natürlich wünschen, dass unser allgemeinbildendes Abitur vielleicht ein kleines bisschen weniger allgemeinbildend ist und mehr der heutigen Zeit entsprechend mehr spezialisiert ist. Dass also den eigentlichen Fächern, für die man sich interessiert und für die man sich entscheidet, dass diesen Fächern mehr Raum gegeben wird, mehr zeitlicher Umfang.
Sodass halt eben solche Kooperationen externe Partner auch wesentlich besser eingebunden werden können. Und dadurch wird es für die Schüler auch einfach viel alltagsnaher. Es hat viel besseren Realitätsbezug, weil sie wirklich sehen, das ist jetzt das, was zur Zeit draußen in der Realwirtschaft, in der realen Forschung abläuft. Und damit kommen wir langsam zum Ende unserer Folge 1 zum Thema Quantum Skills Nachdem wir gute Einblicke bekommen haben, was sich an den Schulen und in der Lehrkräftequalifizierung verändern muss, blicken wir in Folge 2 auf den Arbeitsmarkt. Dann geht es zentral um die Ausbildung der Fachkräfte, die zukünftig in vielen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft mit Quantentechnologien umgehen müssen und zumindest die Grundlagen davon verstehen sollten. Denn die Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind mit Blick auf die Quantentechnologien erstaunlich gut. Ich habe hier noch ein interessantes Statement zum Einstimmen von dem Wirtschaftswissenschaftler Uwe Cantner.
Bis Anfang August der Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI. Diese wissenschaftliche Kommission berät die Bundesregierung. Jetzt schauen wir uns die Quantentechnologien an. Das sind ja dann drei verschiedene Computing, Kommunikation und Sensorik. Und dann stellen wir fest, da ist Deutschland sehr gut aufgestellt im Wissenschaftsbereich. Formidabel, sehr gut, können gut an der Weltspitze mithalten. Das heißt, wir können hier mitspielen und deswegen ist unsere Message oder unsere Handlungsempfehlung an die Bundesregierung, hey Leute, jetzt habt ihr da mal eine Technologie vor der Tür, wo wir super gut sind.
Und jetzt verspielt es nicht in Anführungszeichen schon wieder. Wir freuen uns, wenn ihr neugierig geworden seid. So viel kann ich verraten. Es wird auch um das neue Programm Quantified des Bundesministeriums für Forschung, Transfer und Raumfahrt gehen, was der Stifterverband umsetzt. Hören wir hierzu noch kurz Andreas Land: Mit dem Projekt möchten wir Transparenz schaffen über die konkreten Fachkräftebedarfe. Also welche Kompetenzen werden benötigt in den Firmen, in den Hochschulen auch und in Forschungsinstituten. Das ist eine Besonderheit.
Wenn es Untersuchungen gibt dazu, wird nur die Wirtschaft betrachtet. Aktuell ist es aber so, dass, so vermuten wir, Forschungsinstitute und die Universitäten beziehungsweise Hochschulen also den größeren Fachkräftebedarf haben. Deswegen muss man die mit betrachten in einer umfassenden Fachkräftestrategie. Das war es für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wichtige Links zu den Programmen und Papieren des Stifterverbandes findet ihr in den Shownotes. Bis demnächst zur zweiten Folge zum Thema Quantum Skills. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid.