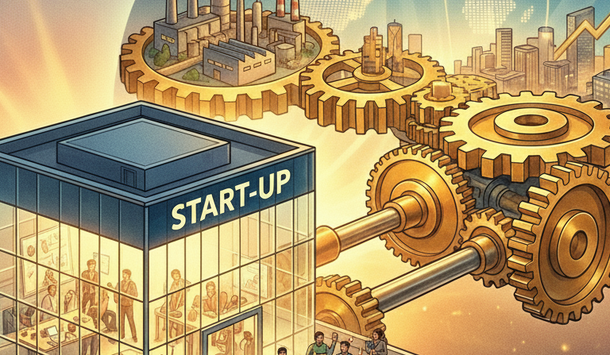Geopolitische Spannungen, sich verschärfende Handelskonflikte – Europa steht vor wachsenden Herausforderungen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie verletzlich der internationale Austausch von Waren und Wissen ist. In einer Welt, in der digitale Technologien und Prozesse Wirtschaft und Gesellschaft immer stärker prägen, gewinnt digitale Souveränität rasant an Bedeutung. Das heißt, Europa muss die Fähigkeit ausbauen, digitale Infrastrukturen, Technologien, Dienste und Daten selbstbestimmt zu kontrollieren als Schutz vor einseitigen Abhängigkeiten.
Europa wird im globalen Technologiewettbewerb nur mitreden können, wenn es kritische Technologien selbst in der Hand hält und digitale Geschäftsmodelle zum Erfolg führt. Die Erfahrung zeigt: Digitale Taktgeber erzielen monopolartige Gewinne und ziehen industrielle Wertschöpfung aus digitalisierten industriellen Prozessen ab. Daraus folgt: Die wirtschaftlichen Kosten „digitaler Unsouveränität“ sind immens.