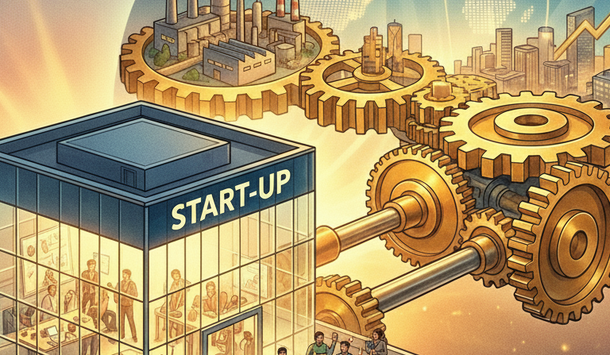Herr Meyer-Guckel, die Welt verändert sich rasant – und das nicht erst seit gestern. Dennoch hat man den Eindruck, dass die Veränderungen immer schneller und tiefgreifender werden. Worin unterscheidet sich die aktuelle Transformation von früheren Transformationsphasen?
Der wesentliche Unterschied ist, dass die aktuellen Transformationsprozesse in unserer Gesellschaft von keiner einzelnen Branche, Disziplin oder Technologie allein bewältigt werden können. Alle Herausforderungen, vor denen wir stehen – die Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften, eine neue Energieversorgung, neue Mobilitätskonzepte, eine neue Gesundheitsversorgung – sind transdisziplinärer Art und politisch extrem komplex, also Multistakeholder-Herausforderungen.
Innovationssystem
„Wir brauchen ein neues Miteinander“

Nehmen Sie etwa die Mobilitäts- oder Energiewende: Dafür brauchen wir Stromtrassen, die akzeptiert werden müssen. Dafür benötigen wir möglicherweise neue Planungsprozesse in Deutschland. Auch das sind Fragen, bei denen Politik und Gesellschaft einen Konsens finden müssen. All diese Fragen – das ist ja das Intersektorale, das ich eben angesprochen habe – müssen schnell geklärt werden. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, die sich für diese Aushandlungsprozesse in der Vergangenheit viel Zeit genommen hat, anders als etwa autokratische Staaten. Das ist eine Qualität unserer Gesellschaft. Aber wir müssen sicherstellen, dass diese Aushandlungsprozesse irgendwann auch zur konkreten Umsetzung führen und nicht in Dauerkonflikten enden, die Lösungen, Fortschritte und Wettbewerbsfähigkeit·verhindern.
Welche Rolle spielt dabei der Stifterverband?
Der Stifterverband ist eine der nationalen Ankerorganisationen, wenn es um das Zusammenspiel zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geht. Wir sind eine Netzwerkorganisation, die genau diese Stakeholder an einen Tisch bringt. Und ich glaube, die Bedeutung solcher Organisationen – wir sind nicht die einzige, aber sicherlich eine der bedeutendsten im zivilgesellschaftlichen Bereich in Deutschland – als Orte für die politische Meinungsbildung und für gesellschaftliche Zielvereinbarungen und Konsensbildungen war noch nie so groß wie heute. Deshalb ist es eine besondere Herausforderung, den Stifterverband gerade in dieser Funktion weiter zu stärken.
„Ich möchte den Stifterverband wieder als Ort der politischen Meinungsbildung im intersektoralen Sinne stärken, ihn als eine Organisation erlebbar zu machen, in der man sich gerne engagiert. “

Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren mehr als 3.000 Mitgliedern konkret, um gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten? Wie können sich Mitglieder einbringen, und wie profitieren sie vom Netzwerk des Stifterverbandes?
Unsere Mitglieder haben vielfältige Hintergründe – zu ihnen zählen Unternehmen, Stiftungen aber auch Einzelpersonen. Sie alle haben die Möglichkeit, im Stifterverband zu bestimmten Themenfeldern gemeinsam ihre Expertise und ihre Ressourcen zu bündeln. Das betrifft insbesondere kleine Stiftungen, die sich in Zeiten niedriger Zinsen die Frage stellen, wie sie überhaupt noch wirkungsvoll agieren können. Meines Erachtens besteht eine große Chance darin, dass man sich auf bestimmten Themenfeldern verbündet, um als zivilgesellschaftliche Gemeinschaftsaktion mehr zu erreichen, als das dem Einzelnen möglich ist. Durch die Bündelung von Ressourcen sowie das Einbringen der eigenen Netzwerke in eine solche Initiative werden viel größere Skalierungspotenztiale und politische Einflussnahmen ermöglicht. Das bietet die gemeinsame Arbeit im Stifterverband.
Netzwerkarbeit ist allerdings nicht einfach zu organisieren.
Richtig. Deshalb müssen wir hier auch neue Wege finden, zum Beispiel mit digitalen Plattformen. Man muss sich nicht mehr zwangsläufig physisch begegnen, um etwas miteinander zu verhandeln und zu tun. Man kann auf solchen Plattformen auch Lerngemeinschaften – nicht nur Aktionsgemeinschaften – zusammenbringen, die sich zu bestimmen Themen austauschen, voneinander lernen und so die Community mit der eigenen Expertise bereichern. Hierin besteht eine große strategische Herausforderung und Chance für den Stifterverband – einerseits die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, dass sich eine solche Arbeit wertschöpfend und noch wirkungsvoller entwickeln kann, und andererseits die notwendige organisatorische Unterstützung dafür zu liefern.
Was genau ist das Erfolgsrezept des Stifterverbandes, um seit mehr als 100 Jahren Zukunft relevant mitzugestalten?
Unser Erfolgsrezept lässt sich unter dem Stichwort Gemeinschaftsinitiative zusammenfassen, das ist der „Basso continuo“ in der Arbeit des Stifterverbandes. Hier ist der Ort, wo sich Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammensetzen und sagen: Was gibt es an neuen Prozessen, an neuen Erkenntnissen, an neuen Technologien? Und welche Folgen haben diese für die Gesellschaft? Also mit Blick auf die Akzeptanz solcher Prozesse, ihre wirkungsvolle Umsetzung und die Art und Weise, wie wir unsere Strukturen als (forschungsstarke) Unternehmen und als Wissenschaft verändern müssen. Wissenschaft ist ja nicht nur die permanente Suche nach neuer Erkenntnis, sondern auch die Frage, welche Voraussetzungen infrastruktureller, organisatorischer und kollaborativer Art eigentlich zeitgemäß sind, um Erkenntnisprozesse zu beschleunigen und daraus Wertschöpfungsprozesse zu machen.
Wie treibt der Stifterverband intern den Wandel voran?
Die Themen, die unsere Mitgliedsunternehmen umtreiben, sind auch unsere Themen. Wie kommen wir zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Handeln? Wie kommen wir zu mehr Diversity? Wie können wir Digitalisierung nicht nur für Effizienz, sondern auch für die Skalierung unserer Arbeit, für mehr Partizipation, Vielfalt oder Internationalisierung nutzen? Und am Ende die große Frage: Welche Wirkungsmodelle haben wir eigentlich, die unsere Arbeit leiten? Das sind die vier Stichworte, die uns als Querschnittsthema in den nächsten fünf bis zehn Jahren begleiten werden.
Es gibt nicht wenige, die Veränderungen kritisch gegenüberstehen. Wie gewinnen Sie Menschen dafür, Wandel zu wagen?
Bei aller Notwendigkeit von gesellschaftlichen Konsensprozessen dürfen wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die bestimmte Veränderungen nicht wollen – etwa aus persönlichen, familiären, wirtschaftlichen, regionalen oder wertegebundenen Gründen. Eine Sache, die wir manchmal vergessen, ist, diesen Menschen zuzuhören und ihre Gründe zu verstehen. Gründe verstehen heißt nicht, einverstanden zu sein. Aber es heißt, auf den anderen zu hören und dessen Argumente mit Respekt zur Kenntnis zu nehmen. Darin liegt viel innovatives Potenzial, auch wenn das zunächst paradox klingen mag. Das ist so ähnlich wie in offenen Innovationsprozessen, bei denen man möglichst viele Stakeholder einbindet und deren Argumente hört, um dann tatsächlich zu einer Innovation zu kommen, die unter Rücksichtnahme dieser Argumente Lösungen erzielt, die, wenn man sie von oben – top-down – durchsetzen will, irgendwann vielleicht auf eine Wand treffen würden. Hier spielen Politik, öffentliche Foren und vor allem auch die Medien eine große Rolle. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der wir so tun, als hätten wir Konsens und in Wirklichkeit gibt es stillschweigenden – oder stillgeschwiegenen – Widerstand, der sich dann in Formen äußert, die uns nicht gefallen.
(Dieses Interview erschien zuerst in der Zeitschrift „Stiftung & Sponsoring“ und wurde für MERTON leicht gekürzt.)