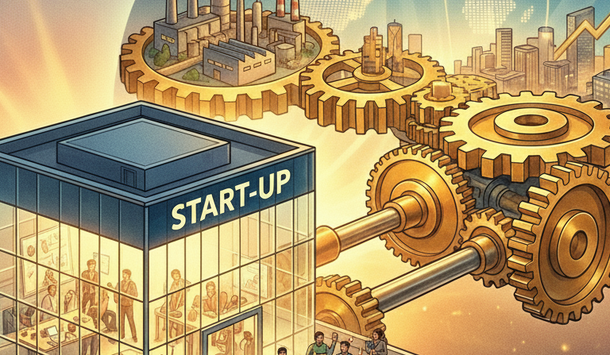Wissenschaftliche Erkenntnisse aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die technologische Entwicklung und den gesellschaftlichen Wandel zu bringen, ist eine der zentralen Herausforderungen für den Innovationsstandort Deutschland. Dies ist nicht nur wichtig, um die Produktion zu steigern und den Wohlstand zu sichern, sondern auch um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch das gelingt, wie ein Blick auf die mäßigen Platzierungen Deutschlands in aktuellen internationalen Transfer- und Innovationsrankings verrät, längst nicht mehr so gut wie früher. Dabei verfügt Deutschland eigentlich über die notwendigen Voraussetzungen, die eigene Innovationsfähigkeit zu steigern: exzellente Hochschulen mit hervorragender Grundlagenforschung, breit aufgestellte Forschungseinrichtungen und eine vielfältige, leistungsorientierte Unternehmenslandschaft. Was es braucht, ist Science Entrepreneurship, also ein Mehr an unternehmerischem Denken und Handeln in der Wissenschaft, sowie ein gründungsfreundlicheres Klima an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen, aber auch ein intensiver Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Nur so können beide Seiten und damit letztlich auch die gesamte Gesellschaft profitieren.
Science Entrepreneurship · Wissenstransfer
Neuer Anstoß für mehr Wissenstransfer

Forschung auf dem Weg in die Praxis: Wie der Stifterverband Transferprozesse an Hochschulen gemeinsam mit Partnern verändern will und was es dazu von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik braucht. Einblicke in das Pilotprojekt IP-Transfer 3.0.
Mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen
Wie das gelingen kann, zeigt ein Beispiel an der TU Darmstadt. Von Darmstadt aus will das im Jahr 2021 an der TU gegründete deutsch-amerikanische Unternehmen Focused Energy die Herstellung von Fusionsbrennstoff zur Marktreife bringen. Ziel ist, Fusionsenergie als saubere, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle auf der Basis moderner Lasertechnologie zu entwickeln und bereitzustellen. 10 Millionen Euro wurden bereits in ein neues Labor investiert, weitere 2,5 Millionen Euro erhielt das Spin-off, das heißt eine forschungsbasierte Ausgründung, im Herbst vom Land Hessen und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Als die Gründer mit dem Know-how, das sie an der TU Darmstadt entwickelt und als Intellectual Property (IP) in Form von Patenten festgeschrieben hatten, den Sprung in die freie Wirtschaft wagen wollten, nahmen sie Kontakt zu Harald Holzer auf. Der Geschäftsführer des Gründungszentrums HIGHEST bot den Gründern ein neues Modell der Rechteübertragung an: „IP for virtual Shares.“ Im Kern bedeutet das, dass die TU Darmstadt die Patente an die Ausgründung abgibt – aber im Gegenzug keine Auszahlung erhält, sondern virtuelle Anteile an dem Start-up. Diese kann sie zu einem späteren Zeitpunkt unter bestimmten Voraussetzungen verkaufen. „Als Universität reichen wir dem Start-up die Hand und übernehmen unternehmerische Mitverantwortung“, erklärt Holzer das Prinzip. Die Universität werde damit zwar virtueller Gesellschafter, greife aber nicht weiter in die operative Unternehmensentwicklung ein. Etabliere sich die Ausgründung erfolgreich am Markt und steige damit der Unternehmenswert, sei bei einem Verkauf der Anteile mit hohen Erlösen zu rechnen.Einer der großen Vorteile für das Spin-off wiederum: Es muss jetzt kein Geld für den Kauf der Patente in die Hand nehmen, sondern kann Kapital in Produkt, Personal und Marketing investieren. Fünf solcher Ausgründungen nach dem neuen Transfermodell hat Holzer mit seinem Team in den vergangenen drei Jahren für die TU Darmstadt veranlasst.

„Als Universität reichen wir dem Start-up die Hand und übernehmen unternehmerische Mitverantwortung.“
Es sind solche Ansätze des Technologietransfers, für die sich Barbara Diehl von der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRIND, begeistern kann. „Die IP-Transferprozesse an den Hochschulen sind meist kompliziert, intransparent und zu langwierig“, sagt sie. Unterstützung leisten könnte zum Beispiel das Projekt IP-Transfer 3.0, das die SPRIND seit 2022 gemeinsam mit dem Stifterverband und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) umsetzt. Im Rahmen des Projektes werden neue Wege für den IP-Transfer getestet, wie beispielsweise die virtuelle Beteiligung an der TU Darmstadt. Denn „wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Spitzenforschung an den Hochschulen finden zu selten den Weg in die wirtschaftliche Anwendung und damit in die Gesellschaft“, sagt Marte Sybil Kessler, die beim Stifterverband das Handlungsfeld „Kollaborative Forschung & Innovation“ leitet. Volkswirtschaftlich gesehen lohne sich das, rechnet sie vor: Jeder Euro, der in Forschung und Innovation fließe, erhöhe die Wertschöpfung um 4 Euro. „Wenn wir in Deutschland die Innovationskraft fördern wollen, brauchen wir einen transparenteren, effizienteren und rechtssicheren IP-Transfer.“
Genau darauf zielt das Pilotprojekt IP-Transfer 3.0 ab, an dem 17 Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde teilnehmen. Sie haben unter anderem eine sogenannte IP-Scorecard entwickelt, mit der sich der Wert des geistigen Eigentums, dem intellectual Property, in Form von Patenten oder Lizenzen besser beurteilen lässt. „Die bisherigen Bewertungsmethoden für IP passen nicht zu einem Ausgründungsprozess, weil die Transferstellen der Hochschulen IP vornehmlich aufgrund eines für Investoren verfassten Businessplans bewerten und die darin enthaltenen Zahlen zumeist zu optimistisch sind“, sagt Diehl. Erarbeitet haben die Projektpartner auch Musterverträge für unterschiedliche IP-Transfermodelle, etwa für die Lizenzierung von Patenten mit oder ohne Kaufoption, den Kauf von Patenten oder für die virtuelle Beteiligung. Diese und weitere Angebote, die in dem Projekt IP-Transfer 3.0 über ein sogenanntes Transfer-Taschenmesser der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sollen den Ausgründungsprozess beschleunigen. Das tut Not: Laut einer Fraunhofer-ISI-Befragung unter 118 Ausgründungen beträgt die durchschnittliche Zeitspanne vom Erstkontakt der Gründungsteams mit der Transferstelle der Universität über eine IP-Nutzung bis zum endgültigen Vertragsabschluss 18,4 Monate. Damit geht der Zeitfaktor als wichtiger Marktvorteil verloren. „Eigentlich sollte dieser Prozess nicht länger als drei bis vier Monate dauern“, sagt Diehl.
Transfer als dritte Säule neben Forschung und Lehre

Doch die Hochschulen stehen vor einer schwierigen Herausforderung: Ihr Hauptaugenmerk gilt häufig den Themen Forschung und Lehre. Transfer als dritte Säule haben sie zwar im Vergleich zu früher durchaus verstärkt auf der Agenda, die Umsetzung ist jedoch an vielen Hochschulstandorten oft noch ausbaufähig. So konstatierte der Transferkompass des Stifterverbandes aus dem Jahr 2022, dass noch immer viele Stellen in den Transferzentren befristet und drittmittelfinanziert sind. Hinzu kämen ungenügende dienstrechtliche Rahmenbedingungen und Unsicherheiten bei der Auslegung des Beihilferechts.
Gut bewertet wird im Transfer dagegen die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen. Ulrike Tagscherer, die beim Maschinenbauunternehmen KUKA das Innovationsmanagement verantwortet, sagt, die Kooperation mit den Hochschulen sei für ihr Unternehmen sehr wichtig, da diese Ideen und Technologien entwickelten. Bei dem Konzern schreiben Studierende ihre Master- und Doktorarbeit, es gibt Projektkooperationen mit Hochschulen und jährlich lobt KUKA den Innovation Award für Technologieentwicklung aus. Der Kontakt zu den Hochschulen ist also vorhanden. Was diesen aber oft fehle, sei der Entrepreneurgedanke. „Natürlich unterscheiden sich die Denkmuster an den Hochschulen von denen in der Industrie. Aber wenn die Hochschulen wirklich Technologietransfer machen wollen, müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel mehr über den Nutzen und mögliche Anwendungen sprechen“, erklärt Tagscherer. Dies sei entscheidend, um in den Markt zu kommen. Zudem mangele es in Deutschland nicht selten an Risikobereitschaft. „Das Sicherheitsbedürfnis ist hierzulande – anders als etwa in den USA, Großbritannien oder China – deutlich höher“, sagt sie. Hilfreich könne es sein, wenn bereits in den Schulen das Thema Entrepreneurship vermittelt werden würde.

„Wenn die Hochschulen wirklich Technologietransfer machen wollen, müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel mehr über den Nutzen und mögliche Anwendungen sprechen.“
Start-ups brauchen mehr Vernetzung mit der Industrie
An der RWTH Aachen hat Lilian Schwich nach ihrem Studium als Teil eines dreiköpfigen Gründungsteams 2022 die cylib GmbH gegründet – ein Spin-off, das ein umweltfreundliches Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt hat, mit dem sich aus ausgedienten Batterien Rohstoffe für den Bau neuer Batterien gewinnen lassen. „In Deutschland gibt es großartige Forschung, doch der Transfer von der Hochschule in die Industrie könnte effizienter gestaltet werden“, sagt die Gründerin. Ein wichtiger Hebel sei die gezielte Unterstützung in der frühen Phase der Ideenfindung. So hätten ihrem Unternehmen an der RWTH Aachen Programme wie der Collective Incubator sehr geholfen, das nötige Wissen für eine erfolgreiche Ausgründung aufzubauen. Wichtig sei auch die Vernetzung mit der Industrie. „Start-ups brauchen frühzeitig den Austausch mit etablierten Unternehmen, um die Marktnachfrage für ihre Innovationen besser zu verstehen und eine klare Richtung für die Kommerzialisierung zu entwickeln“, sagt sie. Hochschulen könnten eine noch aktivere Rolle übernehmen, indem sie Matching-Programme anbieten, gemeinsame Entwicklungsprojekte initiieren und den Zugang zu Industriepartnern erleichtern, die auch bei der technischen Skalierung unterstützen.

„In Deutschland gibt es großartige Forschung, doch der Transfer von der Hochschule in die Industrie könnte effizienter gestaltet werden.“
Unternehmerisches Denken als Wert in der Hochschule verankern
An der TU Darmstadt sieht man sich für den Technologietransfer derweil sehr gut gerüstet. „Wichtige Voraussetzung für mich ist, dass Hochschulleitung und Kanzler unternehmerisches Denken als Wert in der Universität verankert haben“, sagt Harald Holzer. Gespannt ist er nun, wie sich die fünf Ausgründungen entwickeln, von denen die TU virtuelle Anteile hält. Ein Unicorn-Start-up, also ein Start-up mit einer Firmenbewertung durch Risikokapitalgeber mit mindestens 1 Milliarde US-Dollar, werde dabei sein, hofft der HIGHEST-Geschäftsführer. „Für goldene Wasserhähne an der TU wird das zwar nicht reichen“, meint er scherzend, „aber ein sehr hoher Ertrag würde das dann trotzdem für uns bedeuten.“
Vom Wissen in die Anwendung
Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, gilt es, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zu Schlüsseltechnologien noch stärker in die Anwendung zu bringen. Der Stifterverband stärkt mit seinen Aktivitäten den Wissens- und Technologietransfer in Deutschland und unterstützt Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen dabei, mehr und besser finanzierbare, forschungsbasierte Ausgründungen hervorzubringen. Im Pilotprojekt IP-Transfer 3.0 beispielsweise begleitet er gemeinsam mit der SPRIND und dem Fraunhofer ISI 17 Hochschulen und Forschungseinrichtungen dabei, neue IP-Transfer-Modelle zu erproben.
Mehr zum Pilotprojekt IP-Transfer 3.0
Positionspapier zum IP-Transfer
Mehr zum Fokusthema Science Entrepreneurship und Transfer entwickeln
Einander besser verstehen: Ein vertrauensvoller Dialog zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen verbessert den Wissenstransfer. Wie dieser Dialog gelingt? Eine Einordnung von Forschenden aus Wirtschaft und Wissenschaft.