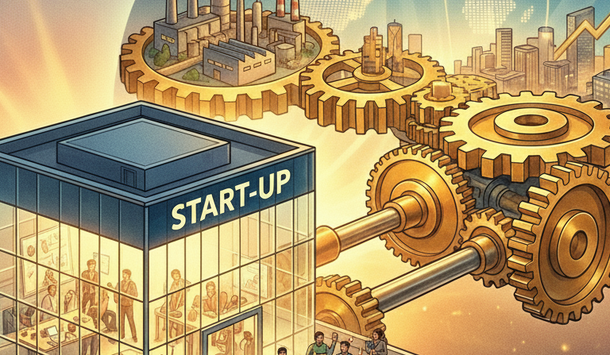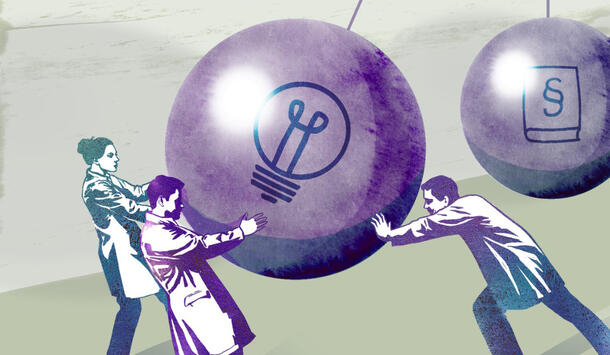Deutschland steht vor einer doppelten Herausforderung: Wachstumsimpulse bleiben aus und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gerät zunehmend unter Druck. Während technologischer Wandel, geopolitische Spannungen und ökonomische Transformationen neue Spielregeln für wirtschaftlichen Erfolg definieren, reicht es nicht mehr aus, allein auf bestehende industrielle Stärken oder inkrementelle Innovationen zu setzen. Es braucht neue Unternehmen, neue Technologien und neue wirtschaftliche Dynamik – kurz: Es braucht Innovationen aus der Wissenschaft.
Die politische Bedeutung von Start-ups als Wachstumstreiber wird zwar immer wieder öffentlich betont, aber institutionell zu selten eingelöst. Insbesondere wissens- beziehungsweise forschungsintensive Gründungen besitzen das Potenzial, nicht nur neue Märkte zu schaffen, sondern auch bestehende Wertschöpfungsketten zu transformieren (Gebert et al. 2025; Bundesverband Deutsche Startups 2024). Denn aus Forschung entstehen Innovationen, aus Innovationen entsteht Produktivität und aus Produktivität entsteht Wachstum. Insbesondere im Bereich Deeptech sind forschungsbasierte Gründungen Treiber von Innovationen und Transformation. Ihre Bedeutung wächst auch angesichts geopolitischer Unsicherheiten: Wollen Deutschland und Europa ihre technologische Souveränität stärken, muss die Abhängigkeit von externen Akteuren bei strategischen (Zukunfts-)Technologien abgebaut werden. Auch weil Deutschland beim Aufbau digitaler Plattformen im internationalen Vergleich ins Hintertreffen geraten ist, kommen Deeptech-Innovationen eine umso zentralere Rolle zu. In diesem Bereich liegen große Chancen: Deutschland rangiert europaweit auf Platz 2 beim Spinout Value seiner Deeptech-Start-ups, während deutsche Hochschulen mit der zweithöchsten Anzahl an Patenten zu den innovativsten in Europa gehören (Dealroom 2025). Voraussetzung, diese Chancen zu nutzen, ist jedoch eine strategischere Förderung: Deeptech braucht einen langen Atem, koordinierte Partnerschaften zwischen Hochschulen, Transferakteuren und Kapitalgebern sowie gezielte Unterstützungsstrukturen, die sich an den Entwicklungszyklen dieser Technologien orientieren.
Solche wissenschaftsbasierten Gründungen entstehen an der Schnittstelle von Forschung, Unternehmen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie beruhen auf komplexem Know-how, technologischen Durchbrüchen und entstehen häufig in zukunftsrelevanten Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Biotechnologie oder Quantentechnologie. Im Vergleich zu forschungsstarken Ländern wie Israel, den USA oder Großbritannien gelingt es aber in Deutschland bislang nicht ausreichend, wissenschaftsbasierte Ausgründungen entstehen und durch Wagniskapital wachsen zu lassen. Die Gründe dafür sind strukturell – und politisch adressierbar.
Das strukturelle Defizit an deutschen Hochschulen ist der Schritt von der Forschung in den Markt. Zwar steigt die Zahl der Ausgründungen aus Hochschulen in Deutschland stetig – laut Gründungsradar des Stifterverbandes von 2021 bis 2023 um 5,3 Prozent pro Jahr (Kessler et al. 2025) - doch gemessen an der Forschungsstärke Deutschlands ist der Output niedrig. Dies hat Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Das Hauptproblem: Gründungsunterstützung ist in Hochschulen kein strategisches Kernelement, sondern ein Randbereich mit geringer Planbarkeit. Rund zwei Drittel der eingesetzten Mittel für die Gründungsförderung stammen aus projektgebundenen öffentlichen Drittmitteln. Dieser dominante Anteil staatlicher Finanzierung schafft kaum Anreize zur Einwerbung privaten Kapitals – entsprechend liegt dessen Anteil bei lediglich 8,3 Prozent. Das hat nicht nur haushälterische Konsequenzen, sondern wirkt sich auch negativ auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus: Wertvolle Netzwerke, Praxis-Know-how und potenzielle Co-Investoren bleiben für viele Gründungsprojekte außen vor. Hinzu kommt: Die Hochschulen selbst leisten nur einen minimalen Beitrag zur Finanzierung - durchschnittlich fließen gerade einmal 0,25 Prozent der Hochschulhaushalte in die Gründungsförderung. Dazu kommen unklare oder konfliktanfällige Regelungen zum geistigen Eigentum, mangelnde institutionelle Anreize für Transferengagement und eine aus Gründungsperspektive oft abschreckende Verwaltungslogik.