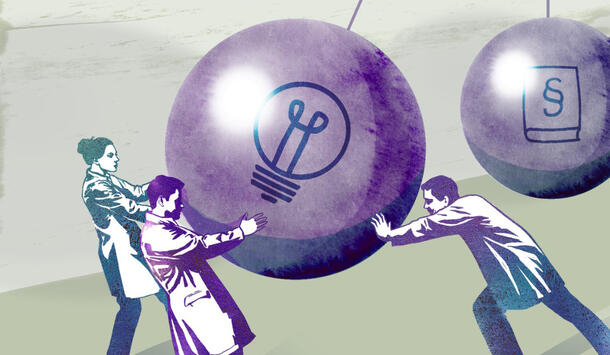Allerdings kann es in der Anbahnung und Planung von Kooperationen durchaus zu Missverständnissen kommen. „Die Unternehmenssphäre und die akademische Sphäre folgen verschiedenen Funktionslogiken. Sie unterscheiden sich in ihren Zielen und Prioritäten, Bedarfen und Prozessen und im Selbstbild der Forschenden“, sagt Anne-Sophie Behm-Bahtat, Programmleiterin „Insights“ bei Wissenschaft im Dialog (WiD). Was zählt mehr: Profit oder Publikationen, Transparenz oder Geheimhaltung, Unternehmenserfolg oder Erkenntnisgewinn? Die Differenzen bleiben oft unausgesprochen. „Schon zwischen Forschenden verschiedener Disziplinen kommt es vor, dass sie denselben Begriff sehr unterschiedlich interpretieren – ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein“, sagt Behm-Bahtat. Und was ein Ingenieur oder eine Ingenieurin in einem Unternehmen unter einem „lebenswerten Umfeld“ versteht, kann ganz anders aussehen, als was sich Grundlagenforschende der Stadtentwicklung darunter vorstellen. „Dann gibt es keine gemeinsame Story, an der sich das Handeln der Kooperierenden ausrichtet.“ Um erfolgreich zusammenzuarbeiten, braucht es zwischen den Forschenden eine frühe und konstante Kommunikation über eigenes Wissen, Hintergründe und Erwartungen.
„Forschende in der akademischen Welt sind sich zudem durchaus bewusst, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in Unternehmensforschung gering ist“, sagt Behm-Bahtat weiter. „Viele fürchten, dass die Skepsis auf sie abfärbt oder sie als ,gekauft‘ gelten, wenn sie mit Unternehmen kooperieren.“ Ein grundlegendes Problem sieht sie darin, dass Forschende aus Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen sich gegenseitig fremd sind. „In ihrem Arbeitsalltag begegnen sie sich kaum.“ Es brauche mehr Räume für Forschende aus beiden Welten, um sich auszutauschen, sich gegenseitig kennenzulernen und das Vertrauen ineinander auszubauen, meint sie. „Wenn das gegenseitige Vertrauen wächst, wirkt das auch nach außen.“ So könne das Vertrauen der Gesellschaft in die Forschung gestärkt werden. „Und die Wissenschaftskommunikation selbst kann sich durch eine stärkere Öffnung gegenüber Forschenden in Unternehmen und Kooperationen weiterentwickeln.“
Viele Forschende wünschen sich eine offenere Kommunikation mit der Öffentlichkeit, auch um Skepsis gegenüber akademisch-industriellen Partnerschaften vorzubeugen. Der Stifterverband und der Fonds der Wirtschaft für Wissenschaftskommunikation haben dieses Anliegen unter anderem in den Diskussionen der FactoryWisskomm vorangetrieben, der Plattform des Bundesforschungsministeriums zur Weiterentwicklung wirksamer und verantwortungsbewusster Wissenschaftskommunikation. Robin Bär meint: „Wir sollten erklären, wie die Prozesse in Kooperationen funktionieren, wie wir gemeinsam auf neue Ansätze kommen, uns gegenseitig helfen … eben die ganze Geschichte erzählen“! Kommunikationsabteilungen könnten als Grundlage dafür die Transparenzregister nutzen, in denen viele Hochschulen ihre Kooperationen mit Unternehmen offenlegen. „Sie bergen wertvolle Information“, meint Bär. Die Geschichten hinter den Daten zu erzählen würde helfen, die gemeinsame Forschung mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Auch die Forschenden selbst könnten aus laufenden Kooperationsprojekten nach außen kommunizieren. „Soziale Medien eignen sich dafür, kleinere Erlebnisse oder Ergebnisse mit überschaubarem Aufwand für interessierte Öffentlichkeiten sichtbar zu machen.“


 Smartphone mit geöffneter App und der Anzeige"It's an match"](/sites/default/files/styles/1080_x/public/2025-04/philip-oroni-s4mbrp_q-e-unsplash_16_9.jpg?itok=4cuhFIk_)