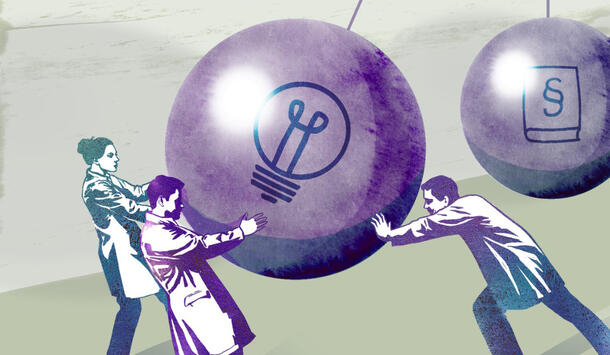Hochschulen sind nicht nur Orte innovativer, exzellenter Forschung und Lehre. Als eine mindestens ebenso wichtige dritte Säule – die Third Mission – hat der Transfer an Bedeutung gewonnen: Hochschulen sollen ihre wissenschaftliche Expertise einbringen, um gemeinsam mit Städten und Kommunen gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Transformationen wie den demografischen Wandel und den Klimawandel zu begleiten. Wissenschaftliche Expertise wird dabei durch das Praxiswissen und die konkreten Bedürfnisse von Akteurinnen und Akteuren außerhalb des Wissenschaftsbetriebs erweitert und ergänzt: – zum Beispiel wenn es um Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, um Mobilität, Umweltschutz oder soziale Teilhabe geht.
Das Ziel ist, eine gemeinsame Transferstrategie mit Kooperationen auf Augenhöhe aufzubauen. Dazu gehört auch, Impulse aus der Gesellschaft als neue Fragestellungen für Forschung und Lehre aufzugreifen. Kooperationspartner für den Transfer sind dabei neben Unternehmen und Handwerkskammern kommunale Behörden sowie politische Institutionen, Vereine, Bürgerinitiativen, soziale Einrichtungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen.