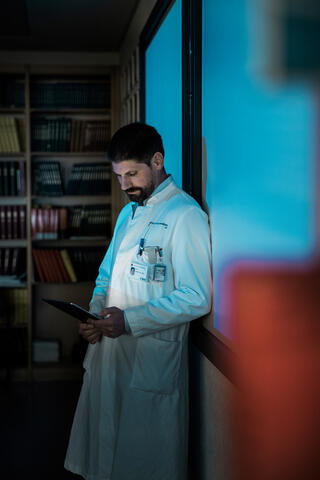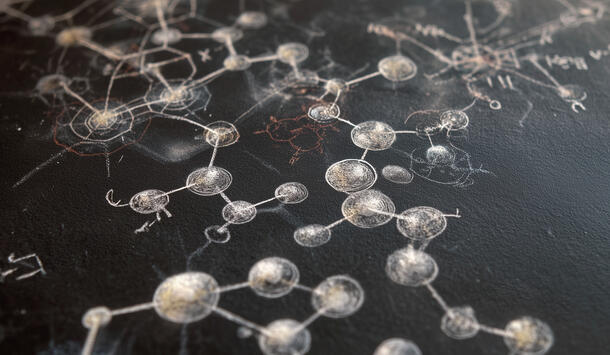Ein Hauch, einen Sekundenbruchteil nur, und das Smartphone schlägt Alarm: Der junge Mann, der gerade in das per Bluetooth verbundene Plastikröhrchen gepustet hat, sieht die Funktionswerte seiner Lunge auf dem Display. Die Linie auf dem Bildschirm ist abgesackt, die Daten zum Atemfluss im roten Bereich. Deutet E das auf eine Verengung der Bronchien hin? Die ausreichende Versorgung des Körpers mit Sauerstoff wäre gefährdet. Der junge Mann hat gelernt, was in solch einem Fall zu tun ist: Er drückt den Kontakt-Button auf dem Bildschirm, um sich mit einem Lungenfacharzt zu verbinden.
An diesem Tag sitzt allerdings kein Facharzt am anderen Ende der Leitung, sondern eine Gruppe Studierender, die sich über ein Notebook mit den Messwerten beugt. Und der vermeintliche Patient ist auch nicht wirklich krank. Dennoch diskutieren die Medizinstudierenden sehr ernsthaft und recht realitätsnah die Behandlungsoptionen: Reicht es, die Medikamentendosis zu erhöhen? Oder müsste der Patient schnell in die Praxis kommen?
Future Skills
Apps auf Rezept

Doch nicht bei jedem Arzt ist es gern gesehen, dass sich Patienten digitale Werkzeuge zunutze machen und etwa nach einer Internetrecherche ihrer Symptome in die Praxis kommen. „Einer Studie zufolge lehnt dies mehr als die Hälfte der befragten Ärzte eher ab. Wartet ein Patient mit so einer Google-Diagnose auf, dann ist schon nach einer Minute das Vertrauensverhältnis gestört“, erklärt Sebastian Kuhn. Hier zeigt sich: Die überwiegende Mehrheit der Mediziner reagiert auf die digitalen Herausforderungen des Arztberufs entweder mit einer Vogel-Strauß-Haltung oder mit einer Ablehnung, die sich aus einer schlechten Informationslage speist. „Ich kann nicht verstehen“, sagt Kuhn ungehalten, „dass manche ignorieren, was um sie herum passiert.“ Der Mainzer Unfallchirurg ist deshalb zum Motor für die digitale Medizin in Deutschland geworden.
Mediziner als Coach eines mündigen Patienten

Begriffe wie opennness, digital makerspace, blended learning, testimonials oder collaboration sind dabei mehr als modisches Wortgeklingel. Sie stehen für eine innovative didaktische Herangehensweise. Statt Fakten im Frontalunterricht vermittelt zu bekommen, erarbeiten die Medizinstudierenden Inhalte gemeinsam, mit ihrem Dozenten, mit Patienten oder mit externen Experten. In dieser Herangehensweise spiegelt sich auch wider, dass sich die Rolle von Medizin und Medizinern ändert. „Der Arzt ist dann dank der Digitalisierung nicht mehr der Halbgott in Weiß, der einem armen Kranken Anweisungen gibt. Sondern der Begleiter oder Coach eines mündigen Patienten“, sagt Kuhn.
Die Übung mit der Lungenfunktions-App zum Beispiel sensibilisiert die angehenden Ärzte für ihr sich veränderndes Berufsbild: wenn sie reihum in die Rolle des Patienten schlüpfen und die Technologie dadurch auch von der anderen Seite erleben. Wenn reale Patienten versichern, die Behandlung via Smartphone habe ihr Leben verändert. Wenn die Entwickler der App Auskunft über die Funktionsweise ihrer Algorithmen geben. Oder wenn in einer Diskussion nicht nur die Vorteile einer effizienteren Behandlung von Lungenleiden zur Sprache kommt, sondern auch die möglichen Nachteile solcher technologischer Lösungen – etwa der Verlust des persönlichen Kontakts zwischen dem Doktor und einem Kranken, der mit seinen Ängsten und Sorgen als Person wahr- und ernst genommen werden will.
Mehr Offenheit für digitale Technik
Die Studierenden, die Sebastian Kuhns deutschlandweit einmalige Lehrveranstaltung besuchen, sollen auf solche Entwicklungen nicht mit Kränkung reagieren, sondern mit grundsätzlicher Offenheit. Dies könne aber durchaus auch zu einer wohlinformierten Ablehnung technologischer Werkzeuge oder Praktiken führen – etwa bei Gesundheits-Apps. 380.000 davon gebe es, „99 Prozent davon sind für den Mülleimer. Die wollen vor allem die Daten der Nutzer ausspionieren.“ Ein Wildwuchs, der entstehe, wenn sich die Medizin das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lasse. Die problematischen Folgen der Entwicklung beobachtet Sebastian Kuhn in der klinischen Praxis: „Dort hat sich WhatsApp als kommunikativer Standard etabliert.“ Ärzte schicken sich darüber Bilder, bei denen es darum gehe, ob die Therapie eines Krebspatienten eingestellt werde – oder eine Notfall-OP stattfinde. Die Rechte an diesen Bildern mit intimen Patienteninformationen gehören WhatsApp, betont der Mainzer Mediziner. Sensible Daten speichere das Unternehmen im Ausland – unklar bleibe, wer wo letztendlich Zugriff darauf hat. Ein Bruch der ärztlichen Schweigepflicht, „auch eine fundamentale Verletzung der Privatsphäre“, sagt Kuhn. Und fügt hinzu: „Hier müssen wir für adäquate, datenschutzkonforme Lösungen sorgen.“
Wenn die angehenden Ärzte seines Seminars die digitale Transformation aktiv gestalten, führe dies keinesfalls zu einer Entmündigung oder einem Verlust der Autonomie des Arztes: Richtig angewandt, könnten die digitalen Assistenzsysteme die Mediziner künftig entlasten für die wirklich wichtigen Aufgaben, glaubt Sebastian Kuhn. „Sehen, hören, fühlen, tasten und mit den Patienten kommunizieren: Basale Fähigkeiten des Arztberufs, die in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden sind, werden in den nächsten zehn Jahren wieder eine ganz große Bedeutung bekommen.“
Serie „Weiter.Denker“

Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir arbeiten. Doch sind wir darauf vorbereitet? Welche Kompetenzen müssen wir dafür mitbringen und wie vermitteln wir diese? Wie müssen wir Bildung, Wissenschaft und Innovation weiterdenken, um wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich nicht den Anschluss zu verlieren. In der Reihe „Weiter.Denker“ stellen wir Personen vor, die bereits vorbildliches leisten, die weiterdenken und versuchen, unsere Zukunft aktiv zu gestalten.
Dieser Beitrag erschien zuerst in: CARTA 2020 - Wieder mal moderne Zeiten