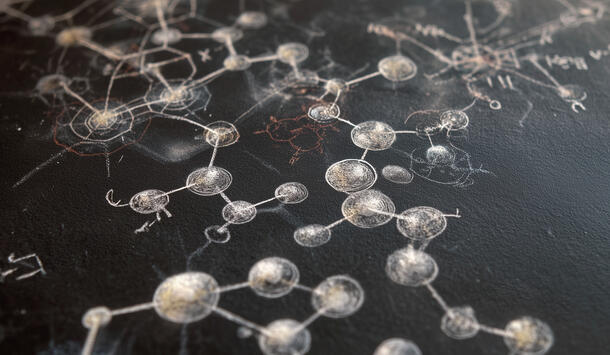Kommunikation – das Reden, Plaudern, Konferieren – ist so alt wie die Menschheit. Und ebenso alt dürfte der Drang sein, nicht nur aus reinem Spaß zu plauschen, sondern weil man gemeinsame Ziele verfolgt. Regelmäßige Abteilungsmeetings gehören deshalb selbstverständlich zu einem Unternehmen dazu: Wo sind wir gerade, wo wollen wir hin, welche neuen Strategien entwickeln wir dafür? In der Arbeitswelt 4.0 bedeutet Kommunikation aber noch viel mehr: sich zu vernetzen oder Wissen zu teilen zwischen Abteilungen oder auch zwischen verschiedenen Unternehmen und anderen Institutionen.
Katharina Krentz ist seit 2005 Mitarbeiterin bei Bosch und seit 2012 dort Expertin für digitale Zusammenarbeit. Sie hat in ihrem Unternehmen eine neue Art der Zusammenarbeit etabliert, die sich „Working Out Loud“ (WOL) nennt – ein Begriff, den der US-Amerikaner und New-Work-Guru John Stepper geprägt hat. WOL steht für offene, transparente Zusammenarbeit mit und in Netzwerken, hauptsächlich im virtuellen Raum. Das will erst einmal gelernt werden. Dafür gibt es bei Bosch sogenannte WOL-Circles. Mithilfe dieser Circle-Methode wird WOL über zwölf Wochen hinweg ganz strukturiert erlebt und erlernt.
Future Skills
Wie Arbeit wieder laut wird: #WOL

Wissen teilen

„Ein Circle besteht aus vier bis fünf Menschen, die im Arbeitsalltag oft gar nichts miteinander zu tun haben, sich im besten Fall auch vorher gar nicht kennen“, erläutert Katharina Krentz. So kann etwa eine Ingenieurin mit einer Kommunikationsreferentin und einem Mitarbeiter aus dem Vertrieb, die an jeweils anderen Standorten des Unternehmens arbeiten, zu einem Circle zusammenfinden.
„WOL ist zunächst einmal eine Haltung und eine Fähigkeit: nach außen gerichtet und transparent zu kommunizieren und die eigene Arbeit und das Wissen zu teilen, anderen zu helfen, um einen Mehrwert für sich selbst und gleichzeitig für das Netzwerk zu generieren“, sagt die 40-Jährige. „Die Circles treffen sich informell im Chat, via Skype, in einer Videokonferenz oder auch persönlich, etwa beim gemeinsamen Essen – es gibt viele Möglichkeiten. Jeder nimmt mit einer individuellen Fragestellung an dem Circle teil: Der eine sucht vielleicht Experten zum Thema Smart Home, die andere möchte ihre Sichtbarkeit in den Sozialen Medien erhöhen, ein Ingenieur möchte seine Expertise über eine Community weitergeben und eine junge Kollegin eine neue Produktidee verwirklichen.“

Jeder der Teilnehmer nimmt sich für die zwölf Wochen ein eigenes Lernziel vor. Alle lernen anhand von sogenannten Circle Guides – einer Art Handbuch mit wöchentlicher Agenda und Übungsaufgaben –, wie man passend zum eigenen Ziel Experten identifiziert, kennenlernt, sich mit ihnen vernetzt und daraus ein nachhaltiges Netzwerk aufbaut. „Der Circle funktioniert wie eine Art Experimentier- und Schutzraum, um diese andere Art des sehr persönlichen Beziehungs- und Netzwerkaufbaus und der Zusammenarbeit auszuprobieren“, erläutert Katharina Krentz. „Und das Spannende daran ist: Über die zwölf Wochen prägt sich so die Haltung und die Fähigkeit, transparent im Netzwerk zu arbeiten, die eigene Arbeit und sein Wissen sichtbar zu machen, andere teilhaben zu lassen, Fragen zu stellen und sich gegenseitig zu helfen, sehr nachhaltig aus. Diese Art der Zusammenarbeit wird zur Gewohnheit und WOL wird gelebter Arbeitsalltag.“ Ihre eigene Erfahrung mit WOL: „Durch das selbst gewählte Ziel und die Arbeit in der kleinen Gruppe geht das Lernen noch einfacher und macht Spaß.“
Im Circle gehe es also um Teilhabe an Wissen. „Und zwar fern der üblichen Give-and-Take-Mechanismen, die normalerweise in Businessnetzwerken oder zwischen Unternehmen vorherrschen“, sagt Krentz. „Tust du mir einen Gefallen, dann tue ich auch dir einen Gefallen“ – eben genau dieses Prinzip soll bei WOL keine Rolle spielen.
„Die wirtschaftlichen Erfolge unserer Unternehmen haben ihren Ursprung im Industriezeitalter. Doch wir müssen uns jetzt im digitalen Zeitalter positionieren, wenn wir weiter erfolgreich bleiben wollen.“

Und dass Circles, die sich aus Mitarbeitern verschiedener miteinander konkurrierender Unternehmen zusammensetzen, keine realitätsferne Spinnerei sind, beweist die Initiative von Krentz ebenfalls: Kürzlich hat sie einen Circle mit Kollegen von Daimler, Audi, Continental, der Deutschen Bank und Siemens initiiert. Alle arbeiten in jeweils anderen Bereichen ihres Unternehmens. „Es funktioniert, weil alle in irgendeiner Form die gleichen Herausforderungen meistern müssen.“ Etwa die digitale Transformation und das Internet der Dinge. Es gehe um übergreifende Themen – und jeder bringe sich dabei ein.
Und viele große Unternehmen haben – etwa im Bereich der Elektromobilität – die gleichen Konkurrenten: Firmen wie das US-Unternehmen Tesla und kleine mobile Start-ups. Katharina Krentz sagt: „Unsere Unternehmen können alle auf eine lange Geschichte zurückblicken. Ihre bis heute stabilen wirtschaftlichen Erfolge haben ihren Ursprung im Industriezeitalter. Doch wir müssen uns jetzt im digitalen Zeitalter positionieren, wenn wir weiter erfolgreich bleiben wollen.“ Aber das funktioniere nur über Partnerschaften, denn nicht jeder könne das Rad selbst neu erfinden.