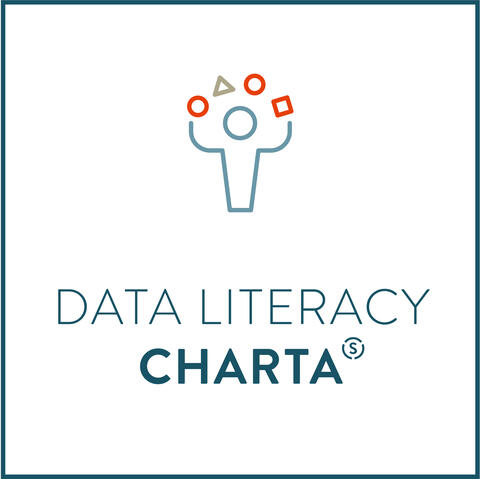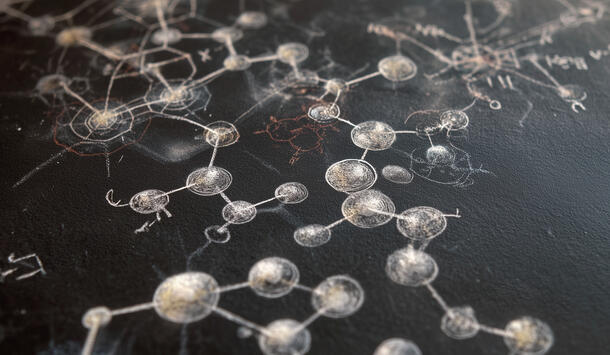Die Pandemie verlangt uns viel ab. Um mal eine positive Nachricht zu hören: Ist der deutsche Mittelstand durch das Social Distancing digitaler geworden, Herr Schwarzer?
Schwarzer: Positiv ist, dass wir branchenübergreifend an die 20 Prozent digitale Vorreiter haben, die ungleich besser durch die Krise kommen. Auf der anderen Seite haben wir leider im Land weit mehr echte Digitalverweigerer, die sinngemäß sagen: Wozu diesen ganzen Online-Unfug, das Internet setzt sich sowieso nicht durch.
Kaum zu glauben! Wie viele sind das?
Schwarzer: Vor der Pandemie waren das bei unseren Befragungen an die 40 Prozent aller deutschen KMU und Steuerkanzleien. Die verbleibenden 40 Prozent wissen zwar, dass sie sich dem Thema Digitalisierung öffnen müssen, finden aber nicht den richtigen Ansatz. Im Krisenjahr haben sie hektisch versucht aufzuholen, was über Jahre hinweg versäumt worden war. Fehlinvestitionen sind da programmiert.
Future Skills
„Wir haben in unserem Land viele Digitalverweigerer“

Gäbe es hierzu vielleicht ein anschauliches Bild, Herr Schwarzer?
Schwarzer: In meinen Vorträgen erläutere ich gerne die unterschiedlichen Blickwinkel im Sinne von „Inside-out“ und „Outside-in“. Da sitzt also die Beobachterin oder der Beobachter am Schreibtisch, schaut aus dem Fenster, sieht den Berliner Dom und denkt sich: Ich sehe meinen Markt, meine Kunden und meine Branche klar vor mir – weil ich die Entfernung von meinem Fenster bis zum Dom auf den Millimeter genau kenne, genauso wie die exakte Zusammensetzung der Dombausteine, die Namen der Baumeister und sogar das Verfallsdatum der Feuerlöschanlage im Inneren. Ich kenne meinen Markt bestens – da macht mir niemand etwas vor.
Das ist die Inside-out-Perspektive, die wir Deutschen so gut beherrschen?
Schwarzer: Ja. Sie ist aber trügerisch: Denn die Kunden sitzen in Wirklichkeit im Helikopter über dem Geschehen. Und von dort aus überblicken sie ganz Berlin, verlieren den Dom also schnell aus den Augen. Stattdessen schweifen die Blicke über die riesige Stadt, die vernetzt ist, Infrastruktur hat, die in Bewegung ist, hier und da neue Gebäude bekommt und an deren vernetzter Struktur unglaublich viele mobile Wesen teilhaben. Das ist „Outside-in“ – die Perspektive, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unbedingt einnehmen sollten.
Meyer-Guckel: Ein eindrückliches Beispiel für das, was Sie gerade beschreiben, Herr Schwarzer, ist mir heute Morgen auf dem Weg zur S-Bahn begegnet: ein Werbeplakat mit dem Slogan „Warum soll ich mich als kranker Mensch zum Arzt aufmachen, um dort zu erfahren, dass ich mich wieder ins Bett begeben soll?“. Absender ist eine Onlineapotheke, die sich jetzt offenbar als Plattform erweitern will, eine Art digitales Ärzteforum, wo Patienten ärztliche Beratung per Video bekommen und das E-Rezept gleich mit dazu. Es könnte sein, dass hier zukünftig nicht nur das deutsche mittelständische Apothekertum bedroht ist, sondern Teile unseres Ärzte- und Krankenkassensystems gleich mit abgeräumt werden sollen. Das sind immerhin Player und Institutionen, die bislang noch jeder Reform trotzen konnten. Jetzt kommt ein neuer Akteur des Weges und denkt zusammen, was Patienten schon lange stört: volle Wartezimmer, Rezept abholen, in der Apotheke anstehen ...
Meyer-Guckel: Wir haben ein massives Weiterbildungsproblem. Der Facharbeiter, der eben noch Vergaser zusammengeschraubt hat, muss jetzt mit Mobilitätsdatensystemen umgehen. Und dieses herausfordernde Reskilling betrifft nicht bloß einzelne Unternehmen, sondern die ganze Branche. Denken wir an „Outside-in“, den Blick aus dem Hubschrauber: Plötzlich ist die Autobranche mit vielen neuen Prozessen vernetzt – Autos kommunizieren mit dem Internet der Dinge, mit Ladestationen, mit dezentraler Energieversorgung. Diese Komplexität ist neu, ungewohnt. Man hat es nicht mehr mit „einem Problem meiner Industrie“ zu tun. Man hat es mit „einem großen vernetzten Miteinander“ zu tun.
Wie kann dieses massive Reskilling unter Zeitdruck gelingen?
Meyer-Guckel: Die einzelne regionale Hochschule, mit der man als KMU immer gut kooperiert hat, kann momentan nur bedingt helfen. Wir sollten Weiterbildung jetzt viel stärker in Vernetzungsplattformen und Verbundstrukturen denken. In diesem Bewusstsein sind aber weder die deutschen Bildungseinrichtungen noch die KMU.
„Wir müssen weg von dem Irrglauben, Data Literacy sei lediglich ein Thema für Computernerds. “

Wird das ausreichen? Herr Schwarzer, Sie sprachen eben die fehlende digitale Kompetenz an. Man bezeichnet sie als Data Literacy – ein sperriger Begriff, der vielen erst wenig sagt.
Schwarzer: Ich muss gestehen, bevor wir uns dem Programm des Stifterbandes gewidmet haben, war mir dieser Terminus auch nicht geläufig.
Was meint dieser Begriff genau?
Schwarzer: Data Literacy steht, wie gesagt, im weitesten Sinne für Datenkompetenz. Was der Einzelne darunter versteht – dazu herrscht in unserer Gesellschaft tatsächlich noch eine babylonische Sprachverwirrung: in der Digitalpolitik, im Bildungssektor, in der Weiterbildung, in der Wirtschaft.
Der Stifterverband spricht von „einer grundlegenden Kompetenz“, die man braucht, um in der digitalen Welt in Wissenschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen und teilhaben zu können.
Meyer-Guckel: Genau. Data Literacy ist die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen. Man lernt, wie man sie im jeweiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen kann. Also die ganze Bandbreite: Wie man Daten erfasst, erkundet, managt, kuratiert, analysiert, visualisiert, interpretiert, kontextualisiert, beurteilt und anwendet.
„Wenn ich als Unternehmer bloß meinen IT-Beauftragten fortbilde, dann habe ich schon verloren. Data Literacy ist wirklich so etwas wie das neue Rechnen, Lesen und Schreiben. “

Wenn man das jetzt alles zusammendenkt: Was sind in der Data-Literacy-Education die nächsten wichtigen Schritte?
Meyer-Guckel: Wir müssen weg von dem Irrglauben, Data Literacy sei lediglich ein Thema für Computernerds.
Schwarzer: Absolut. Wenn ich als Unternehmer bloß meinen IT-Beauftragten fortbilde, dann habe ich schon verloren. Data Literacy ist wirklich so etwas wie das neue Rechnen, Lesen und Schreiben. In den zahllosen Familienunternehmen muss deshalb vor allem auf den Chefetagen dringend nachgebessert werden – es sei denn, der IT-Leiter soll zukünftig das Businessmodell des gesamten Unternehmens neu denken!
Meyer-Guckel: Jeder Hochschulabsolvent sollte Data Literacy beherrschen, aber auch jeder Bürger sollte sich zumindest in den Grundzügen damit auskennen.
In Ihrem gemeinsamen Netzwerk Data Literacy Education fließt gerade die Kompetenz aus 24 deutschen Hochschulen zusammen, um die Frage zu beantworten, wie Data Literacy flächendeckend in alle möglichen Disziplinen integriert werden kann.
Meyer-Guckel: Ja, das sind die Vorreiter, allesamt Hochschulen, die Data Literacy bereits in ihre Organisations- und Curriculumsentwicklung zentral einfließen lassen. Dort werden die Diskussionen, wie Data Literacy an jeden Studierenden vermittelt werden kann, schon flächenübergreifend geführt.
Schwarzer: Sie haben alle bereits Beachtliches auf diesem Gebiet geleistet. Die Universität Lübeck beispielsweise war vor einigen Jahren noch eine rein medizinische Universität. Man entschied sich gegen einen eigenen Informatiklehrstuhl und integrierte stattdessen Data Literacy in bestehende Curricula. Diese erfolgreiche Synthese von Medizin und Informatik zeigt eindrücklich, wie interdisziplinär das Thema Data Literacy ist.
Die Stifterverbands-Charta fasst die wichtigsten Punkte zusammen und definiert Leitprinzipien. Wie hoch sind Ihre Erwartungen?
Meyer-Guckel: Unsere Charta wird die Welt nicht revolutionieren. Aber wenn wir jetzt tatsächlich gemeinsam in so etwas wie eine nationale Bewegung kommen, wobei unsere Charta sicher mithelfen kann, dann haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht.
Schwarzer: Ich denke auch: Das wäre ein großer und wichtiger Schritt in Richtung Zukunft.