Der Austausch auf Augenhöhe macht das Seminar „Lebenswelten“ besonders. Mehrere Lehrkräfte berichten dort vom eigenen steinigen Bildungsweg, von unerfüllten Berufswünschen, Alltagshürden, aber auch von Freizeitaktivitäten und persönlichen Lebenszielen. Diese Offenheit schafft Vertrauen: Studierende trauen sich, in diesem Seminar Fragen zu stellen, die sie anderswo aus Sorge, jemandem zu nahe zu treten, nicht gestellt hätten: Warum reagieren manche Behinderte schroff, wenn man ihnen Hilfe anbietet? Können Menschen mit einer geistigen Behinderung wichtige Entscheidungen eigenverantwortlich treffen? Ist der Wunsch nach einer eigenen Familie für Menschen mit Behinderung tabu oder nicht? Können Menschen mit Behinderung genauso glücklich sein wie Nichtbehinderte?
Antworten hierauf geben die Lehrkräfte gern und kompetent, denn Inklusion ist ihr Spezialgebiet: Das Lebenswelten-Seminar wird von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung gegeben, die in Kiel zur Bildungsfachkraft qualifiziert wurden. Authentischer könnte Lehre zum Thema Inklusion kaum sein.
Chancengerechtigkeit
Hochschule statt Behindertenwerkstatt – wie Inklusion auch in der höheren Bildung gelingt

Bildungswege müssen nicht in der Behindertenwerkstatt enden
Es steckt aber auch etwas Brachiales in diesem Lehrangebot, könnte man sagen, denn es reißt eine lange dagewesene Mauer ein. Bislang war der Zutritt zur höheren Bildung für geistig beeinträchtigte Menschen verbaut. Man verwies sie auf die Behindertenwerkstätten. Das ist eure Welt, hieß es, Punkt.
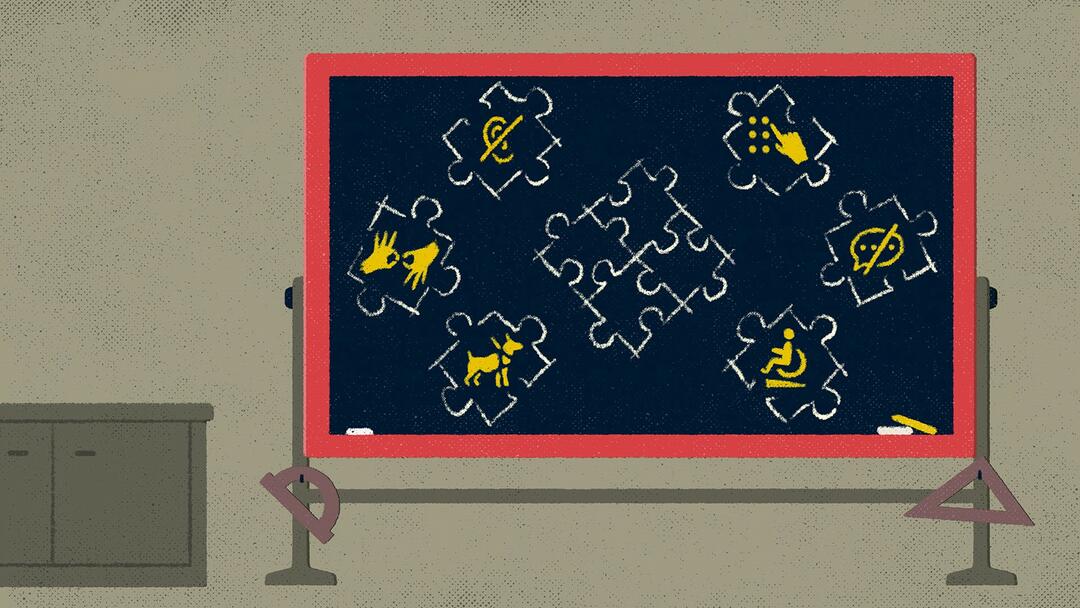
Dass dieses langgehegte Verständnis unhaltbar ist, gegen geltendes Gesetz verstößt, verstaubt und falsch ist – das hat Gesa Kobs mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewiesen. Sie ist Geschäftsführerin des Instituts für Inklusive Bildung. Es besteht seit 2016 und wurde damals vom Vorsitzenden der Stiftung Drachensee gegründet, Jan Wulf-Schnabel. Das Institut für Inklusive Bildung ist ein An-Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Es beschäftigt die weltweit ersten Bildungsfachkräfte mit Behinderung, in Festanstellung, wohlgemerkt. Deren Aufgabe: als Expertinnen und Experten Inklusionskompetenzen an Hochschulen vermitteln.
Das ist völlig neu. Bis dato lehrten und redeten auf dem Campus ausschließlich Nichtbehinderte über Inklusion und das Leben von Menschen mit Behinderung. Jetzt bildet das Institut speziell Menschen mit geistiger Behinderung über drei Jahre hinweg in Vollzeit für ein ergänzendes Lehrangebot aus. Ihre Erfahrungen sind mancherorts sogar schon Teil des Curriculums.
„Ich galt früher als Problemfall und bin heute ein Vorbild.“
Eine kleine Sensation in der Hochschulwelt
Menschen mit geistiger Behinderung, die Studierende an der Universität ausbilden? Das ist eine kleine Sensation. Außenstehende runzeln oft die Stirn, wenn sie davon hören, denn was soll das bringen? Man versteht zwar, dass Menschen mit geistiger Behinderung vielleicht im Hochschulseminar von ihrem Leben erzählen können – aber darüber hinaus?
Zuversicht geben Gesa Kobs die Bildungskräfte selbst. 2013 startete die erste Qualifizierung mit sechs Personen, die geistige Behinderungen haben. Alle arbeiteten vorher in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Diese Pionierinnen und Pioniere starteten 2016 an der Universität zu Kiel mit ihren Seminaren. Gesa Kobs beobachtete über Jahre hinweg ihre außergewöhnliche persönliche Entwicklung – was sie lernten, wie sie über sich hinauswuchsen – und war tief beeindruckt. Ihr wurde klar: Das Institut für Inklusive Bildung stellt nicht nur das System Hochschule in Sachen Inklusion mit seinen Aktivitäten auf den Kopf, es verändert auch das Leben der beteiligten Bildungskräfte massiv.

Was war bislang der größte Erfolg des Projekts?
Es gibt drei enorme Meilensteine, die unseren Erfolg gut darstellen. Wir qualifizieren Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung zu Bildungsfachkräften, damit sie als Lehrende an Hochschulen Inklusionskompetenzen vermitteln. Dass wir diesen weltweit einzigartigen Ansatz erstmalig erfolgreich in Kiel umgesetzt haben und hierbei inzwischen sechs Menschen sozialversicherungspflichtig als Bildungsfachkräfte beschäftigt sind, ist der erste Meilenstein unserer Erfolgsgeschichte.
Der zweite riesige Meilenstein ist die Tatsache, dass wir die gerade beschriebene Idee an sechs weiteren Hochschulstandorten bereits initiieren konnten und begleiten dürfen. Bis Ende 2023 wollen wir die Qualifizierung zur Bildungsfachkraft an insgesamt zehn Hochschulstandorten etablieren. Und mit dem Preis von Wirkung hoch 100 sind wir einen weiteren großen Schritt in Richtung eines „Disability Mainstreamings“ gegangen, womit die Absicht gemeint ist, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen.
Welche Wirkung konnte unser Projekt bislang erzielen?
Die sechs Bildungsfachkräfte aus Kiel konnten 2020 in etwa 80 Lehrveranstaltungen rund 5.000 Studierende direkt erreichen. Die daraus resultierende multiplikative Wirkung ist sehr hoch, denn diese Studierenden werden später im Beruf als Lehr-, Fach- und Führungskraft ihre so erworbenen Inklusionskompetenzen sicher auch anwenden und weiter in die Gesellschaft hineintragen. Das ist eine Wirkung, die bereits viele begeistert. Dutzende Hochschulstandorte aus Deutschland, Österreich und Großbritannien wollen deshalb erfreulicherweise das Konzept des Instituts für Inklusive Bildung übernehmen.
Welche Fördermöglichkeiten wünsche ich mir für die Zukunft?
Wir möchten definitiv Mainstream und ein fester Bestandteil der bestehenden Hochschulsysteme werden. Bildungsfachkräfte sollten als Expertinnen und Experten in eigener Sache an der Hochschule direkt angestellt werden. Wir möchten uns also am liebsten überflüssig machen. Bis es so weit ist, brauchen wir starke Partnerinnen und Partner an unserer Seite, die uns unterstützen.
Vorbild sein und Berührungsängste nehmen
Samuel Wunsch zählt zu ihnen und trat schon mehrfach vor Publikum auf, um über seine positive Wandlung zu berichten. Anfang 2020 hielt er eine Rede vor dem österreichischen Parlament, wo er seinen schwierigen Bildungsweg beschrieb: „Ich galt früher als Problemfall und bin heute ein Vorbild.“ Die Qualifizierung habe ihm Hoffnung gegeben, mehr aus sich zu machen. In der Behindertenwerkstatt schnitt Wunsch tagein und tagaus Kabel in kleine Stücke, eine monotone Arbeit.
Heute ist er weitaus selbstbewusster und durch die dreijährige Institutsqualifizierung in der Lage, seine Emotionen zu beherrschen, die ihm früher oft im Weg standen. Samuel Wunsch lernte, wie höhere Bildung organisiert ist, wie Teamarbeit funktioniert und Konflikte ausgetragen werden können. Er lernte das Zuhören und Erzählen, das Zugehen auf andere. Er kann vor großem Publikum eine Rede darüber halten, was ihn als Person mit seinem spezifischen Erfahrungsschatz besonders macht und warum Menschen mit Behinderung die besten Expertinnen und Experten sind, um Nichtbehinderten die Berührungsängste vor der inklusiven Bildungsarbeit zu nehmen.
Die Ideen sprudeln. Mit der Förderung des Stifterverbandes will das Institut sein Konzept weiter skalieren. Deutschlandweit sollen bis Ende 2023 vier weitere Hochschulstandorte hinzukommen, die mithilfe des Instituts selbst Bildungsfachkräfte ausbilden. In sechs Städten war das Konzept im Herbst 2021 schon an Hochschulen implementiert: in Heidelberg, Köln, Stendal, Leipzig, Dresden und Neubrandenburg.
Piller glaubt, dass das Institut mit seinem Ansatz deutschlandweit eine Struktur implementieren kann, die das Thema Inklusion in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen auf eine höhere Ebene hebt. Und es gebe noch eine weitere Dimension, warum das Projekt vom Stifterverband ausgezeichnet wurde: „Diese Idee der speziell ausgebildeten Fachkraft, die im Hörsaal ihr authentisches Wissen weitergibt, lässt sich als Blaupause auch auf andere Themenfelder ausweiten, wie etwa Altersdiskriminierung, Mobbing oder soziale Ausgrenzung.“







