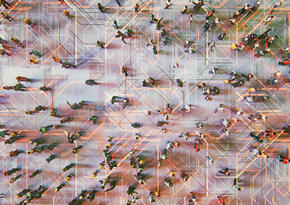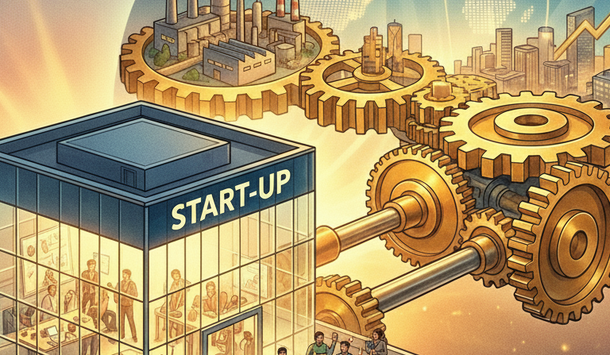Die guten Ideen und Lösungen sind längst in der Welt. Sie werden oft nur übersehen, wo sie dringend gebraucht werden. Diese Erfahrung machte auch Hendrik Ballhausen, ein Physiker, Ökonom und Unternehmensberater, der heute die Forschungsverwaltung der Medizinischen Fakultät an der LMU in München managt. Ihm fiel auf: Seit Jahrzehnten können eindrucksvolle Kryptotechnologien dezentrale Datenanalysen absichern. Warum aber ist bei ihren Anwendungen immer bloß von Bitcoins oder Blockchains die Rede? Das machte ihn stutzig.
Innovationssystem
Daten tauschen und schützen – das muss kein Widerspruch sein

Daten schützen und dennoch austauschen

Hendrik Ballhausen sieht die Wissenschaft, die Wirtschaft und Behörden diesbezüglich gerade an einem Scheideweg, ob sie ihre sensiblen Daten großen Cloudanbietern oder entsprechenden Dienstleistungsplattformen anvertrauen sollten oder nicht. „Bisher haben sie nicht wirklich eine Wahl, weil es für sie im Grunde keine dezentralen verschlüsselten Analyticsangebote gibt“, so Ballhausen. Expertinnen und Experten für Kryptografie sind rar und werden von multinationalen Unternehmen, wie Blockchain- und Cryptocurrency-Start-ups, hart umworben. Das Nachsehen haben ebenso wichtige Kryptografie-Anwendungen für alltägliche Prozesse deutscher oder europäischer Forschungslabore, Behörden oder kleinere Unternehmen.
Und genau an dieser Stelle setzt das von Ballhausen angestoßene Projekt „Federated Secure Computing“ (FSC) jetzt an. Die Technologie des LMU-Spinoffs „bytes for life“ will Kryptotechnologie nicht nur für die Medizin und andere Forschungsbereiche zugänglich machen, sondern ebenso für den Mittelstand, den Bildungssektor, Behörden oder Citizen-Science-Initiativen. Dazu entwickelt es eine sogenannte „Middleware“, die die komplizierte Kryptografie auf den Server oder in die Cloud verbannt. Über eine klar definierte Schnittstelle sind die lokalen Anwendungen dann viel einfacher zu entwickeln.
„Intelligenter Datenschutz made in Germany und digitaler Fortschritt gehen zusammen und beißen sich nicht mehr. “
Erklärtes Ziel ist: eine wasserdichte Datensicherheit und absolute Datensouveränität zu garantieren, auch wenn mehrere Akteurinnen und Akteure für Analysen ihre Daten „zusammenwerfen“. Der Clou dabei ist, dass niemand seine Daten für solche Analysen herausgeben beziehungsweise vorzeigen muss – alles läuft verschlüsselt ab und die Daten „wandern“ zu keiner Zeit irgendwohin und müssen auch keiner zentralen Institution gegeben werden. Ausgetauscht werden lediglich lange Zahlencodes.
Um es plastisch zu machen: Wenn zwei Mittelständler beispielsweise herausfinden wollen, inwieweit sich ihre Lieferketten ähneln, kann Firma X die Namen ihrer 20 Lieferanten verschlüsseln und diesen Zahlencode an Firma Y senden. Bei Firma Y wird dieser Code dann erneut verschlüsselt. Dasselbe Verfahren läuft von Firma Y in Richtung Firma X. Am Ende lassen sich die zweifach verschlüsselten Codes vergleichen und die Firmen erfahren so, in welchem Maß ihre Lieferketten identisch oder konträr sind – obwohl kein Lieferantenname ausgetauscht wird und die Firmengeheimnisse so gewahrt werden. All das läuft über das System automatisch ab.
Revolution in der Datenanalyse
Was sich schlicht anhört, ist in Wahrheit eine kleine Sensation, wie der junge IT-Experte Philipp Riederle berichtet: „FSC ermöglicht in der Datenanalyse eine völlig neue Art des Denkens. Wir können plötzlich auch Daten analysieren, auf die wir keinen direkten Zugriff haben – das ist revolutionär!“ Riederle ist Unternehmensberater zu Fragen rund um die Arbeitswelt 4.0. Das BMBF zeichnete ihn 2014 mit gerade einmal 19 Jahren als einen der „führenden digitalen Köpfe Deutschlands“ aus.
Welches Innovationspotenzial in dem Vorhaben von FSC steckt, fiel auch in der Jubiläumsinitiative „Wirkung hoch 100“ des Stifterverbandes auf. Mitte November krönte ihr Beirat, dem auch Philipp Riederle angehört, das LMU-Projekt als Gewinner für das Handlungsfeld „Innovation“. FSC erreichte damit die höchste Förderstufe des Programms und bekommt, neben 140.000 Euro aus der vorangegangenen Förderphase, weitere 10.000 Euro für die Umsetzung und Skalierung des Projekts. Im Vorjahr war das Jubiläumsprogramm noch mit 100 herausragenden Projektideen aus Bildung, Wissenschaft und Innovation in eine erste Förderphase gestartet.

Was war bislang der größte Erfolg des Projekts Federate Secure Computing?
Seit April 2021 steht unsere Einstiegslösung als freie und quelloffene Software der Allgemeinheit zur Verfügung. Dieser Schritt Richtung systemische Wirkung macht uns richtig glücklich.
Welche Wirkung konnte das Projekt bislang erzielen?
Wir haben bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Behörden und Unternehmen einen Aha-Effekt erreicht: Wer hochspannende Datenanalysen mit anderen zusammen umsetzen will, muss dafür seine Daten nicht hergeben. Intelligenter Datenschutz made in Germany und digitaler Fortschritt gehen zusammen und beißen sich nicht mehr!
Welche Fördermöglichkeiten wünsche ich mir für die Zukunft?
Wirkung hoch 100 hat uns für die Startphase sehr gut ausgestattet. Noch mehr als weitere Förderungen wünschen wir uns, das sich Nutzerinnen und Nutzer in unserem Projekt engagieren.
Wie geht es weiter?
Mit der Förderung von Wirkung hoch 100 ist es für Ballhausen und seinem Team nun möglich, Show Cases für Forschung, Wirtschaft und Behörden zu entwickeln, um die Potenziale der Technik bekannter zu machen. Auch die Tatsache, dass das Team sich für einen Open-Source-Ansatz entschied, soll bei der Verbreitung helfen.
Jede und jeder könne nun diesen Ansatz nutzen und weiterentwickeln, lobt Philipp Riederle. Wer möchte, könne den Code auch auf Herz und Nieren prüfen, ob er in Sachen Datenschutz halte, was das Projekt FSC verspreche. Diese Transparenz werde in der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft sehr geschätzt und deshalb dringend gebraucht, erklärt der IT-Experte weiter: „Ich glaube deshalb, dass das Anliegen von FSC unseren europäischen und insbesondere auch den deutschen Blick auf das Thema Datenschutz und Privatsphäre ungemein stärken kann.“