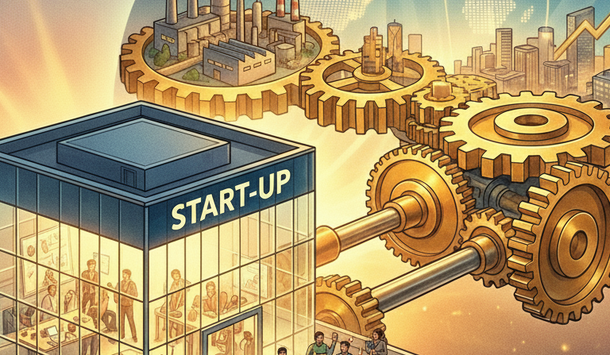Deutschland wird von der OECD das geringste Wachstum im Jahr 2025 vorhergesagt. Wir sehen eine seit Jahren wachsende Produktivitätslücke gegenüber den USA und das Ausbleiben einer Verbesserung in den Wettbewerbsindikatoren internationaler Vergleichsstudien. Die Nachrichten über das deutsche Innovationssystem sind alarmierend. Und das trotz weltweit wettbewerbsfähiger Forschungsinstitutionen sowie eines insgesamt vergleichsweise hohen Anteils der Forschungsausgaben am BIP von Wirtschaft und Staat. Wie passt das zusammen? Oder andersherum: Warum passt das nicht zusammen?
Das Problem: Forschungserfolge werden hierzulande wenig effektiv in marktgestaltende, ökologisch verträgliche und gesellschaftlich relevante Innovationserfolge umgewandelt. Deutschland ist stark in der Forschung, aber schwach in der Umsetzung. Innovation ist eben mehr als Transfer, sie ist immer auch ökonomisch erfolgreiche Umsetzung von neuen Ideen und Lösungen. In den USA liegt die Anzahl an Unicorns, also von jungen Unternehmen mit einem Marktwert von über 1 Milliarde US-Dollar pro Kopf, um den Faktor 4.5 über dem in Deutschland. Das muss uns zu denken geben. Ebenso finden neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft ihren Weg nur schwer und langsam in politische Entscheidungsfindungen und gesellschaftliche Gestaltungsprozesse. Lösungen zu komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen werden sich so nicht realisieren lassen, wenn wir versuchen, diese mit Forschungsansätzen in disziplinären Komfortzonen anzugehen. Im Gegenteil, die interdisziplinäre Natur dieser Herausforderungen verlangt eine neue Konvergenz disziplinärer Stärken auch unter Einbeziehung moderner sozial- und politikwissenschaftlicher, rechtlicher und ethischer Kompetenzen. Nur mit einem solchen gesamtheitlichen wissenschaftlichen Ansatz und unterstützt durch eine innovationsoffene Politik werden technologische Errungenschaften wie beispielsweise in der Fusionsforschung, im biomedizinischen Engineering, im Bereich der künstlichen Intelligenz, des neuronalen Computings oder in den Quantentechnologien auch bedeutsame wirtschaftliche Wertschöpfung und gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. In diesem Sinne sind auch tradierte Rollenverständnisse für Wissenschaftseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen, Politik und Gesellschaft zu überprüfen und neu zu justieren, sodass ein kluges und vertrauensvolles Miteinander zwischen all jenen entstehen kann, die zu neuen Erkenntnissen und Erfindungen oder zur erfolgreichen Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft beitragen können.