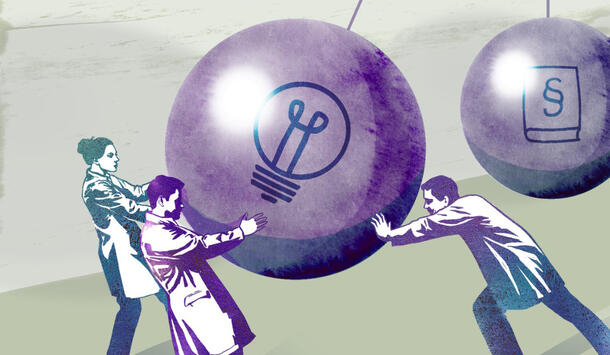Die Third Mission ist für Hochschulen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Hochschulen sollen gesellschaftliche Veränderungen mit ihrer Expertise aktiv begleiten. Was braucht es dafür?
Um Transformationsprozesse in einer Stadt oder einer Region nicht nur zu beforschen, sondern nachhaltig daran beteiligt zu sein, braucht es Konzepte, an denen auch Akteurinnen und Akteure außerhalb des Wissenschaftsbetriebs gleichberechtigt mitwirken – bottom-up statt top-down. Sei es beim Thema nachhaltige Energieversorgung, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Wohnen im Alter oder Quartiersmanagement: Wer, wenn nicht die Menschen aus der Praxis und die Bürgerinnen und Bürger, die gesellschaftliche Veränderungen erleben und sich eine lebenswerte Zukunft wünschen, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spiegeln, welche Innovationen gebraucht werden? Nur so kann sich letztlich nachhaltige Wirkung entfalten.
Wissenstransfer
Hochschule und Region: Gemeinsam Gesellschaft gestalten

Die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit lassen auch die Erwartungen an die Wissenschaft steigen: An Hochschulen soll nicht nur gelehrt und geforscht werden, sondern sie sollen als Third Mission auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, an der Zukunftsfähigkeit von Regionen aktiv mitwirken und mit ihrem Wissen Innovationen vorantreiben. Der Stifterverband fördert im Transformationslabor Hochschule solche Aktivitäten. Was Hochschulen in der Zusammenarbeit mit ihrer Region bewirken können, erklärt der Schirmherr des Programms, Uwe Schneidewind, im Interview.
Nennen Sie ein paar Beispiele?
Im Norden von Wuppertal ist durch die zivilgesellschaftliche Initiative Utopiastadt e. V. mit Unterstützung der Stadt Wuppertal und der Universität Wuppertal das soziokulturelle Zentrum Utopiastadt Campus entstanden. Unter anderem wurde die Fläche rund um den alten ehemaligen Bahnhof Wuppertal-Mirke von der Initiative übernommen und in ein Reallabor für nachhaltiges Bauen, Wohnen und Zusammenleben umgestaltet. Bürgerinnen und Bürger können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern quasi dabei zusehen, wie sie in Forschungsprojekten neue Ideen entwickeln und diese auf dem Areal erproben.
Gibt es einen roten Faden, der sich durch erfolgreiche Transfervorhaben zieht?
Die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers kann ein solcher roter Faden sein. Oder gemeinsame Vorhaben wie die Verbesserung und Weiterentwicklung von Infrastrukturen. Das kann man an den geförderten Konzepten im Transformationslabor Hochschule sehr gut sehen.


Lebendige Quartiere am Reißbrett zu entwickeln, die Wissenschaft, Kultur und Wohnen verbinden, aber nicht abends wie ausgestorben wirken, das funktioniert sicherlich nicht so einfach.
Darum ist ein gemeinsames Konzept und das Zusammenbringen relevanter Akteurinnen und Akteure so wichtig. Die vom Stifterverband geförderte TU Braunschweig beispielsweise entwickelt in den kommenden Jahren mit der Stadt Braunschweig den CoLiving Campus: ein Stadtquartier, das Wissenschaft und Stadtgesellschaft im urbanen Raum zusammenbringt und schon in der Entwicklungsphase zur aktiven Mitgestaltung einlädt. Es wird nicht über die Menschen in Braunschweig hinweg geplant, sondern mit ihnen gemeinsam. Unabhängig von diesem konkreten Beispiel: „Gemeinsam“ muss, wie schon gesagt, nicht immer ein gemeinsames neues Areal bedeuten, sondern kann, wie etwa im Fall des geförderten Konzepts der Hochschule Bochum und der Stadt Herne, auch die Etablierung neuer Bürgerbeteiligungsformate sein.
„Wer, wenn nicht die Menschen aus der Praxis und die Bürgerinnen und Bürger, die gesellschaftliche Veränderungen erleben und sich eine lebenswerte Zukunft wünschen, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spiegeln, welche Innovationen gebraucht werden?“
Eine Hochschulleitung kann Transferaktivitäten nicht einsam beschließen, es funktioniert nur, wenn Leitung und wissenschaftlich Arbeitende an einem Strang ziehen. Wie etabliert man einen gemeinsamen Transfer-Spirit?
Hochschulen können das unter anderem durch eine gezielte Berufungspolitik steuern: Die Third Mission als wichtiges gemeinsames Ziel muss in die Ausschreibung einer Professur aufgenommen werden, verbunden etwa mit Anreizen wie einem reduzierten Lehrdeputat für Transferengagement. Es gibt bereits einige Universitäten wie etwa die Leuphana-Universität in Lüneburg oder die Universität Oldenburg, die Nachhaltigkeit und Transfer in Lehre und Forschung als Teil ihrer DNA betrachten. Das wiederum zieht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, die sich engagieren wollen und denen neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor allem die Frage wichtig ist: Welchen Nutzen hat meine Forschung eigentlich jenseits wissenschaftlicher Paper? Daneben spielt auch die Lehre eine wichtige Rolle: Studiengänge, die den Transfergedanken als Social Learning und mit transdisziplinären Lehrformaten in ihr Curriculum aufnehmen und so den wissenschaftlichen Nachwuchs von Anfang an damit vertraut machen.
Engagement allein reicht meistens nicht – es braucht auch Mittel, um Transferaktivitäten nachhaltig zu finanzieren.
Deshalb sind Programme wie das des Stifterverbands so wichtig für den Anschub: Damit verbunden ist nicht nur finanzielle Förderung, sondern es bietet auch Vernetzungsmöglichkeiten und Austausch mit anderen Hochschulen. Und eine Förderung durch den Stifterverband ist meistens ein Türöffner für Anschlussförderungen durch andere Institutionen. Zudem: Etliche Hochschulen haben mittlerweile feste Fördertöpfe für Transfervorhaben eingerichtet – damit gute Projekte verstetigt werden können.

Transformationslabor Hochschule
Der Stifterverband fördert Transferaktivitäten seit Jahren in vielfacher Form: Er analysiert in Studien die Lage, erkennt die Trends und moderiert den Weg, um miteinander zu Lösungen zu kommen, die im Alleingang nicht erreichbar wären. Mit dem Programm Transformationslabor Hochschule begleitet und fördert er zudem Transferaktivitäten an Hochschulen. Das Besondere ist die Verschränkung der Hochschulperspektive mit der kommunalen Perspektive bei der Gestaltung und Umsetzung von Transformationsprozessen. Die Förderung besteht aus einem einjährigen Programm, das Hochschulen und Kommunen auf der Umsetzungs- und auf der Leitungsebene durch Workshops und Coachings sowie mit strategischen Impulsen und Vernetzung unterstützt. Zusätzlich werden die teilnehmenden Hochschulen mit je 25.000 Euro gefördert. Unterstützt wird das Programm von Bildungschancen und der Gemeinnützigen Bruno Steinhoff Stiftung für Wissenschaft und Forschung.
Mehr zum Transformationslabor und den ausgezeichneten Hochschulen
Mehr zu den Stifterverbands-Aktivitäten im Fokus Impact of Science stärken
Die neue Legislatur bietet die Chance, Weichen neu zu stellen. Was heißt das für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem? Eine Vision für das Jahr 2035 von Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbandes.