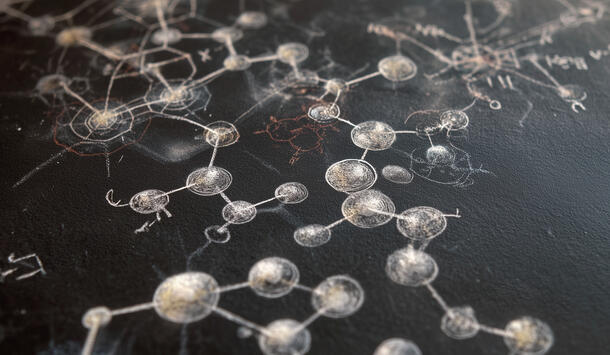„Sollte ich nur noch kalt duschen?“ Das fragte eine Schülerin von Fridays for Future die Astrophysikerin Cecilia Scorza vor vier Jahren. Es ging um persönliche Strategien gegen den Klimawandel. Scorza wurde hellhörig und dachte: „Die jungen Menschen brauchen dringend mehr Ideen, was sie alles machen können, damit die Energiewende wirklich gelingt.“
Auch deshalb ist das Bildungsprogramm „Der Klimawandel – verstehen und handeln“ entstanden: Damit das Wissen über die „großen Hebel“ gegen die Erderwärmung bei der jungen Generation ankommt. Cecilia Scorza stieß dieses Programm 2018 an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) an. Aus ihrer Sicht war es überfällig: Weil die Folgen der Erderwärmung unter jungen Menschen bereits „eine große Betroffenheit“ auslösen, sie dieses Gefühl aber kaum in Selbstwirksamkeit, eigene Initiativen oder ihre Berufswahl ummünzen können.
Der Grund für dieses Handlungsdefizit ist schnell ausgemacht: An vielen deutschen Schulen werden weder Klimaphänomene noch Handlungsoptionen gegen die Erderwärmung, wie die Energiewende, ausreichend im MINT-Unterricht behandelt. Es fehlen Lebensbezüge und relevante Inhalte für die Schülerinnen und Schüler. Und das liegt laut Cecilia Scorza daran, dass entsprechende Unterrichtsmaterialien und didaktische Konzepte für die MINT-Fächer fehlen.
Future Skills
Forschungswissen verständlich in die Schule bringen

Die Aufgabe: Schulbildung mit Wissenschaft verknüpfen

Noch – könnte man sagen, denn sie arbeitet mit ihrem Team intensiv daran, dass beides vor Ort ankommt. Forschungswissen verständlich „in die Schule zu bringen“ ist ihr Metier. Die gebürtige Venezolanerin verknüpft seit mehr als 20 Jahren in Deutschland Wissenschaft mit Schulbildung. Für ihre Leistungen als Brückenbauerin zwischen diesen Welten bekam Scorza bereits mehrere Auszeichnungen, wie den Scientix Preis der EU. Sie gab für diese Transferarbeit auch ihre Forschungstätigkeit auf.
Aktuell koordiniert die Astrophysikerin an der physikalischen Fakultät der LMU München die Öffentlichkeitsarbeit, Schulkontakte und Fortbildungen für Lehrkräfte. Die Idee für das Programm „Der Klimawandel – verstehen und handeln“ reifte mehrere Jahre in ihr. 2018 konnte sie den Münchner Lehrer Moritz Strähle dafür begeistern. Beide legten gemeinsam los. Seitdem hat das Projekt erstaunlich viel erreicht.
Problem Bildungsförderalismus
Cecilia Scorzas Expertise puscht das Programm „Der Klimawandel - verstehen und handeln“ enorm. Auch ihr Mann, der bekannte und gut vernetzte Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch, ist mit an Bord und erreicht eine große Öffentlichkeit für das Projekt. So konnte das Bildungsangebot bereits eine Dynamik entwickeln, die ihresgleichen sucht. Es trifft nicht nur den Nerv der Zeit und ist deshalb so gut wie in jeder Schule willkommen. Es konnte darüber hinaus eine der ärgsten Hürden nehmen, die es für die Skalierung deutscher Schulbildungsprojekte gibt: die Grenzen der Bundesländer.
Normalerweise scheitern an dieser Hürde selbst die besten Projekte reihenweise: weil sie die unterschiedlichen föderalen Vorgaben der Kulturministerien für Lehrpläne nicht erfüllen können. Sie werden sozusagen von der Sisyphusarbeit, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, überrollt.
Das Programm „Der Klimawandel – verstehen und handeln“ wählte für diese Herausforderung einen überraschend einfachen Weg: Es denkt die Prozesse dezentral und bindet aus jedem Bundesland möglichst viele vernetzte Sachverständige als Mitstreiterinnen beziehungsweise Mitstreiter ein. Die zeitraubende Arbeit verteilt sich so auf viele kompetente Köpfe und Schultern.
Parallel zum Bildungsangebot entstanden Fortbildungen für Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen und andere Bildungsträger, damit sie den Klimakoffer bestmöglich einsetzen können. Scorza und Strähle überlassen nichts dem Zufall. Sie wollen, dass Lehrerinnen und Lehrer diesem Unterrichtsangebot möglichst viel Raum geben – weil es nur so die volle Wirkung entfalten kann.
Was war bislang der größte Erfolg des Projekts?
Der größte Erfolg ist, dass wir das komplexe Phänomen „Klimawandel“ für die Schule in Form von Experimenten elementarisiert haben. Wir sind inzwischen mehr als 30 Aktive, die mit dem Klimakoffer zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel vorhaben. 2021 bekamen wir bereits Hunderte Anfragen für den Klimakoffer aus Schulen und mehrere Einladungen von Stiftungen und Universitäten. Allein in Deutschland stehen wir über ein Lehrernetzwerk mit mehr als 600 Lehrkräften im Austausch. Sogar an der Universidad Industrial de Santander in Bucaramanga in Kolumbien wird der Klimakoffer bereits nachgebaut und bis tief in die Andengebiete zum Schulunterricht verschickt.
Welche Wirkung konnte unser Projekt bislang erzielen?
Wir sind bundesweit schon sehr gut in der Fläche vernetzt, mit völlig unterschiedlichen Partnern. Dutzende Universitäten, Fachhochschulen, School Labs, Bildungszentren und Schulen haben ihre eigenen Bildungsprojekte mit unserem Bildungsprogramm ergänzt und machen es sich zu eigen. Gemeinsam kommen wir alle viel schneller voran. Man kann sagen, dass aus unserem Projekt 2021 eine Bottom-up-Initiative geworden ist, die immer mehr an Fahrt aufnimmt.
Welche Fördermöglichkeiten wünsche ich mir für die Zukunft?
Wir wünschen uns mehr Unterstützung von Stiftungen und Unternehmen, die unsere Aktivitäten fördern beziehungsweise sponsern wollen. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Schulen, die sich keine eigenen drei oder vier Klimakoffer leisten können. Diese Schulen brauchen also unsere Unterstützung, damit das Projekt auch bei ihnen ankommen kann. Schon jetzt sind Anfragen bei uns eingetroffen, ob wir Hunderte Klimakoffer zeitnah liefern können. Aber wir starten gerade erst mit der Produktion. Ich sehe dieses enorme Interesse als eine große Chance, dass wir in den Schulen derzeit viel bewegen könnten. Wir sollten sie nutzen.
Unterrichtskonzept: Verstehen und Handeln
Ohne Frage – dieses Lernangebot kann Tage füllen. Es gibt dem MINT-Unterricht plötzlich auch eine neue Rolle, wie Gunilla Neukirchen beschreibt, weil dieser Unterricht durch seine Kombination von Verstehen und Handeln nicht bloß Wissen vermittele, sondern eine echte Verbundenheit mit Technik und den Naturwissenschaften anstoßen könne.
Neukirchen gehört dem Beirat von Wirkung hoch 100 an und ist Schulleiterin am Beethoven-Gymnasium in Berlin-Lankwitz. Sie weiß aus Erfahrung, dass gerade Mädchen einen haptischen Zugang zu diesen Themenfeldern sehr schätzen und das Erlernte auch mit sozialen Aspekten verbinden wollen.